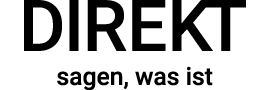Wenn eine Person, deren Aufenthaltsrecht an den oder die Lebenspartner:in gekoppelt ist, sich wegen häuslicher Gewalt trennt, läuft sie Gefahr, ihre Aufenthaltsbewilligung zu verlieren. Das Parlament will dies nun ändern: Nach dem Nationalrat hat nun auch der Ständerat einer Gesetzesänderung zugestimmt – auch wenn letzterer die Anpassung in zwei Punkten noch deutlich abschwächen will.
Anna Tanner, Sozialarbeiterin im Frauenhaus Bern, zeigt sich sichtlich erleichtert: «Diese Anpassung zur Härtefallpraxis bei häuslicher Gewalt wird vielen betroffenen Personen sehr viel Druck wegnehmen». Im Interview mit «direkt» schildert sie die Probleme der bisherigen Gesetzgebung und was die Änderung für Betroffene bedeutet.

«direkt»: Die bisherige Regelung im Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) zu häuslicher Gewalt hat dazu geführt, dass Migrant:innen in Gewaltbeziehungen verharren. Sie befürchten, dass sie bei einer Trennung ihre Aufenthaltsbewilligung verlieren. Dies, obschon 2005 eine Härtefallbestimmung ins Gesetz aufgenommen wurde. Warum greift diese Gesetzgebung dennoch zu kurz?
Anna Tanner: Die aktuelle Gesetzgebung ist sehr eng gefasst. Sie gilt zum Beispiel nur für verheiratete Personen und die Handhabung variiert je nach Kanton oder zuständiger Behörde. Es ist zudem schwierig, häusliche Gewalt nachzuweisen. Wenn ein Gericht zu wenig Beweise dafür sieht, stehen die Chancen für ein Härtefallgesuch sehr schlecht. Viele gewaltbetroffene Personen haben verinnerlicht: «Wenn ich mich trenne, verliere ich mein Aufenthaltsrecht.» Dies führt dazu, dass sie sich bereits davor fürchten, die Gewalttaten zur Anzeige zu bringen.
Mit der angepassten Gesetzgebung können nun auch Opferhilfe-Institutionen eine Einschätzung zur Situation der Gewaltopfer abgeben. Anhand dieser Berichte können wir neu auch subtile, emotionale und sexualisierte Gewalt darlegen. Für diese gibt es oft keine Beweise.
Der Ständerat hat nun aber entschieden, dass nur anerkannte Opferhilfestellen den Opferstatus anerkennen können und nicht alle Schutzunterkünfte. Denn nicht alle Schutzunterkünfte sind anerkannte Opferhilfestellen. So zum Beispiel das Frauenhaus Aargau-Solothurn. Diese Anpassung würde die ungleiche Behandlung in den verschiedenen Frauenhäusern verstärken, was nicht zielführend ist. Ich hoffe deshalb, dass diese Anpassung in der Differenzbereinigung im Nationalrat wieder korrigiert wird.
«direkt»: Wie äussert sich die bisherige Gesetzeslücke in Ihrem Arbeitsalltag im Berner Frauenhaus?
Anna Tanner: Ganz viele Frauen wollen sich trotz der Gewalterfahrungen nicht von ihrem Partner trennen. Oft droht der Partner ihnen auch und benutzt die Gesetzgebung als Druckmittel: «Wenn du dich trennst, verlierst du alles und musst zurück in dein Herkunftsland.» Davor haben viele Angst: Als geschiedene Frau zurückzukehren wäre für viele gefährlich und perspektivenlos.
Wir sagen den Frauen jeweils schon, dass es die Möglichkeit für ein Härtefallgesuch gibt. Wenn wir aber die Kriterien schildern, geben die meisten bereits – oft auch zurecht – schon vor dem mühseligen Prozedere auf.
«direkt»: Welche Verbesserungen bringt die neue Gesetzgebung konkret?
Anna Tanner: Dass dieses Gesetz nun geändert werden soll, nehmen wir hier mit grosser Erleichterung auf. Es gibt jenen Institutionen mehr Kompetenzen, welche die Betroffenen und deren Situation gut kennen. Für die Beurteilung eines Falls ist das höchst relevant. Zudem gilt die neue Gesetzgebung auch für Gewaltopfer, die nicht verheiratet sind, wie beispielsweise Kinder, Konkubinatspaare und eingetragene Partnerschaften.
Wichtig im neuen Gesetz wäre zudem, dass die Frauen nicht sofort die Integrationskriterien erfüllen müssen. Wenn diese aufgrund einer Behinderung, einer Krankheit oder aus anderen gewichtigen persönlichen Gründen wie eben bei Traumatisierungen durch häusliche Gewalt nicht erfüllt werden können, soll dem Rechnung getragen werden. Leider hat der Ständerat auch hier entscheiden, dass dieser Teil gestrichen werden soll. Der Ball liegt jetzt wieder beim Nationalrat.
«direkt»: Denken Sie, dass die Gesetzesänderung Frauen dazu verhilft sich aus einer gewaltvollen Beziehung zu lösen oder gibt es noch andere Faktoren, die dazu führen, dass sich Gewaltopfer nicht trennen?
Anna Tanner: Die Angst vor einer Ausschaffung ist sicher einer der wichtigsten Gründe, warum sich Migrant:innen in Gewaltbeziehungen nicht trennen. Ich gehe davon aus, dass viel weniger Frauen von ihrem Partner unter Druck gesetzt werden können, sobald bekannt wird, dass diese Regelung geändert wurde. Hier ist es sehr wichtig, dass eine breite Kommunikation stattfindet. Die bisherige Unsicherheit hat denn auch dazu geführt, dass bereits getrennte Frauen wieder zu ihrem Partner zurückgingen. Oft kommen diese Frauen früher oder später wieder zu uns. Besonders tragisch ist dies, wenn auch Kinder betroffen sind. Die neue Gesetzgebung macht Trennungen von einem gewalttätigen Partner ohne Angst nachhaltig möglich.
Das Frauenhaus Bern bietet gewaltbetroffenen Frauen und deren Kindern Wohnraum für begrenzte Zeit. Dabei erhalten die Frauen auch umfassende Opferhilfeberatung. Dazu gehört die Kommunikation mit der Arbeitsstelle der Frauen, Sicherheitsvorkehrungen, psychologische Unterstützung, Krisenintervention, die Analyse der finanziellen Situation inklusive des Aufgleisens nötiger Massnahmen, die Unterstützung beim Stellen von Strafanzeigen und Eheschutzgesuchen etc. Das Frauenhaus Bern hat zudem die Kompetenz, rechtliche Leistungen, die im Opferhilfegesetz geregelt sind, zu sprechen und arbeitet im engen Austausch mit anderen Institutionen wie der KESB, den Schulen, den Sozialdiensten und anderen.