Das Gesundheitswesen avancierte zum Top-Thema des Wahlkampfs 2023. Politikerinnen und Politiker aller Lager fühlen sich derzeit im Wahlkampf verpflichtet, «Lösungen» gegen die Prämienexplosion anzubieten. Nur wenige verzichten darauf, das Gesundheitssystem als krank und Bundesrat Alain Berset als schuldig einzuteilen. Was da dem Volk alles an Stuss von Vorschlägen präsentiert wird!
FDP-Aufsteiger Andri Silberschmidt dokumentiert seine überragende Kompetenz mit der einsichtigen Forderung, im Spital müsse halt «Wasser statt Champagner» verabreicht werden.
Die FDP will, in Anlehnung an die Migros-Billiglinie, eine «Budget-Versicherung» für die Einkommensschwachen. Andere FDP-Kandidaten propagieren, wie gewohnt und reflexartig, «mehr Wettbewerb» im Gesundheitsmarkt. Und der FDP-Aufsteiger Andri Silberschmidt dokumentiert seine überragende Kompetenz mit der einsichtigen Forderung, im Spital müsse halt «Wasser statt Champagner» verabreicht werden.
Die Zürcher SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli erklärt, wohl aus Resignation mit ihrer Zürcher Spitalpolitik, das System mit der obligatorischen Krankenversicherung als «finanziell gescheitert». Der weisere und realistischere Berner Kollege und SVP-Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg schlägt hingegen einkommensabhängige Prämien vor.
Neben den systemischen Reformvorschlägen zum Gesundheitssystem hören wir ein Sammelsurium von Sparvorschlägen: Die Senkung der CEO-Löhne bei den Krankenversicherungen, die oft 700’000 Franken übersteigen, auf das Bundesratslohn-Niveau; die Kürzung der Alternativmedizin; eine Begrenzung der diversen Vorsorgeuntersuchungen; die Verkürzung der Spitalaufenthalte und sogar eine Ausgrenzung der «kostentreibenden» Migrantinnen und Migranten. Kurz: eine Vielzahl an skurrilen Je-Ka-Mi-Erfindungen. Diese signalisieren die Hilflosigkeit der Politik bei der Steuerung der wachsenden Gesundheitskosten.
Was der Bund erreicht hat
Immerhin: Einige Sparanstrengungen hat der Bundesrat durchgesetzt. In der 12-jährigen Ära des Gesundheitsministers Alain Berset gab es ein Mehrfaches von Sparvorlagen – im krassen Unterschied zur Laisser-Faire-Politik unter den Vorgängern Pascal Couchepin und Didier Burkhalter. Sie beide konnten sich von den Fesseln der Interessenlobbys im eigenen Lager nie befreien. Die von Couchepin aufgegleiste Vorlage zur Einschränkung der freien Arztwahl scheiterte kläglich in der Volksabstimmung.
An behutsamen Reformschritten in den letzten 12 Jahren wurden:
- die Aufsicht des Bundes über das Krankenversicherungssystem total neu geordnet;
- die zuvor provisorisch immer wieder verlängerte Ärzte-Zulassung nach mehreren Anläufen definitiv geregelt;
- die Qualitäts-Kontrolle moderat verbessert;
- die Medikamentenpreise in mehreren Anläufen um insgesamt 1200 Millionen gesenkt;
- beim Ärzt:innen-Tarifsystem Tarmed rund 500 Millionen eingespart;
- die überrissenen, technologisch längst überholten Labortarife um 200 Millionen gedrückt;
- neuerdings für die Zukunft die Generika-Preise nochmals leicht herabgesetzt (Einsparung 250 Millionen) und – was mehr ins Gewicht fallen wird – der Patienten-Selbstbehalt bei weiterem Gebrauch von Originalpräparaten auf 40 Prozent angehoben.
Was an den Lobbyinteressen gescheitert ist
Zahlreiche Sparanstrengungen im Gesundheitssystem und bundesrätliche Vorlagen wurden im Parlament blockiert oder verwässert. Zum Beispiel:
Zum Beispiel hat die Gesundheits-Lobby folgendes verhindert:
- Das vorgeschlagene Referenzpreissystem für Generikapreise wurde gänzlich gestrichen und bleibt immer noch hängig (Wegfall von 350 bis 480 Mio Fr Einsparungen).
- Ein System zur Kostensteuerung wurde derart mit Fussangeln und Ausnahmen geschwächt, dass es nur begrenzt durchsetzungsfähig ist.
- In einem zweiten Kostendämpfungspaket wurde schon in der Vernehmlassung das Prinzip «zuerst Hausarzt dann Spezialarzt» fallen gelassen. Danach wurde eine koordinierte Versorgung zwecks Kostendämmung im Nationalrat gänzlich versenkt.
- Mehrere Anläufe zur Senkung der Medikamenten-Kosten (z.B. die Halbierung der überhöhten Generika-Preise) wurden zurückgewiesen.
- Die Vorlage für eine einheitliche Finanzierung von stationären und ambulanten Spital-Leistungen wurde blockiert und steckt im Herbst 2023 immer noch im Parlament fest.
Nur dank den verfahrensrechtlich vorgeschriebenen Behandlungsfristen kamen im Parlament ein Gegenvorschlag für die Prämienentlastung der Versicherten (aufgrund der Prämienentlastungs-Initiative der SP) und ein Gegenvorschlag zur stark demontierten Kostenbremse (aufgrund der Initiative der Mitte) zustande. Ersterer ist jedoch ungenügend und deckt nur einen Bruchteil der Prämienbelastung der Versicherten ab. Und die Kostenziele gemäss Mitte-Vorschlag wurden auf eine Vierjahres-Überprüfung abgebaut.
Für Krankenkassen, Ärzteverbände und Pharma lobbyierten in dieser Legislatur im National- und Ständerat sage und schreibe 90 Parlamentarier und Parlamentarierinnen.
Der Mitte-Präsident Gerhard Pfister hat die Situation der Gesundheitspolitik im Parlament auf den Punkt gebracht: «Die vielen Interessenlobbys, die im Parlament vertreten sind, blockieren sich gegenseitig.»
Für Krankenkassen, Ärzteverbände und Pharma lobbyierten in dieser Legislatur im National- und Ständerat sage und schreibe 90 Parlamentarier und Parlamentarierinnen, sowie dutzende weiterer zugewandter Verbandsvertreter.
Die Komplexität des Systems macht es fast unsteuerbar
In keinem andern System des Service public treffen so viele gegensätzliche Stakeholder, Akteure und Nutzniesser aufeinander: Hausärztinnen, Spezialärzte, Spitäler, Apothekerinnen, Pflegeheime, Pharmaindustrie (Hersteller von Originalpräparaten versus Generika-Produzenten), Generika-Importeure und natürlich die Krankenkassen. Zudem ist die Systemteuerung verwirrend-föderalistisch aufgeteilt zwischen Bund und Kantonen, flankiert durch die Mitwirkung von Verbänden, Universitäten und Lobbys. Und irgendwo am Rande, nicht im Zentrum, stehen der Patient und die Prämienzahlerin.
Alle versprechen, verdrängen, schummeln – Kosten steigen weiter
In den letzten 25 Jahren seit dem Krankenversicherungs-Obligatorium – das 1995 einen Meilenstein darstellte – sind die Prämien im Durchschnitt um 3,5% pro Jahr gestiegen. Und sie werden in dieser Grössenordnung weiter zunehmen. Gleichzeitig wachsen auch die staatlichen Gesundheitsausgaben der Kantone und des Bundes weiter.
Die technologische Entwicklung im Gesundheitssektor und die diagnostisch-therapeutische Mengenausdehnung werden weiter gehen. Die Bevölkerung wird immer älter und ihr Therapie- und Pflegebedarf steigt. Und das vielgepriesene elektronische Patientendossier wird den bürokratischen Mehrbedarf der Ärzte und Pflegefachpersonen weiter ausdehnen. Das Wachstum des Gesundheitssektors geht weiter. Das ist der Trend in allen hochentwickelten Wohlfahrtsgesellschaften.
Ideal wäre ein Systemwechsel zu einkommensabhängigen Krankenkassenprämien.
Gewiss muss man an vielen Punkten gleichzeitig ansetzen: bei der Systemsteuerung zwischen Bund und Kantonen, bei den Medikamentenpreisen, mit der Stärkung der Hausarztmedizin und der HMO-Modelle, aber auch mit mehr Selbstverantwortungselementen, etwa mittels Barbeteiligungspauschalen bei der Beanspruchung der extrem teuren Notfallzentren im Spital. Das System braucht politische Führung und Steuerung – und Eingrenzung der Lobbys!
Die Schlussfolgerung: Ideal wäre ein Systemwechsel zu einkommensabhängigen Krankenkassenprämien. Doch dieser wird wohl am Volksmehr scheitern. Die Realität zeigt sich vielmehr so: Die Schweiz will sich – das scheint der Minimalkonsens von links bis rechts – weiterhin ein hoch qualitatives und halt kostspieliges Gesundheitssystem leisten. Das kostet mehr. Zwei Drittel bis drei Viertel der Bevölkerung sind in der Lage, die wachsenden Prämien aufzubringen. Und für die Haushalte mit weniger Geld, braucht es eine gezielte und wachsende Prämienverbilligung durch den Staat. Das scheint wie eine Resignationslösung. Aber nur sie ist ehrlich und die einzig realistische.
Rudolf Strahm, war SP-Nationalrat, und eidgenössischer Preisüberwacher. Er wirkte vier Jahre als Präsident des bernischen und 13 Jahre als Präsident des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbandes (Deutschschweiz).
Die Kolumne ist eine «Carte Blanche» und widerspiegelt die Meinung des Autors.
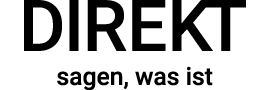






Der Denkfehler bei der Einkommensabhängigen Prämien ist folgender:
1. Meist sind diese nach oben gedeckelt. Dadurch bezahlen die oberen paar Prozent im Verhältnis zu wenig, währendem diejenigen, die ein wenig was verdienen massiv zur Kasse gebeten werden. Letztlich öffnet sich die Schere dadurch noch weiter.
2. Sehr gut verdienende und Reiche können sich locker Konstrukte leisten, um solche Abgaben zu umgehen resp. niemals im Verhältnis die korrekt Höhe bezahlen zu müssen
Meines Erachtens kann das Ziel nicht sein, nur das Machbare zu tun, sondern es muss das Notwendige machbar gemacht werden. (Auch die AHV hat ja mehrere Anläufe gebraucht.) Neben dem Ausbau der Prämienverbilligung gehört für mich daher auch die Einkommensabhängigkeit der Prämien zu den Schwerpunkten. Vor vielen Jahren hat sich die SP zudem für die Einheitskasse im Bereich der Grundversicherung stark gemacht. Mit Argumenten, die für mich heute noch gültig sind, wie z.B. Kosten durch viele Parallelstrukturen. Viele Krankenkassen bedeuten zudem viele Kassenwechsel. So haben per Anfang 2023 rund 1,1 Millionen Versicherte die Kasse gewechselt. Jeder einzelne Wechsel bedeutet zusätzliche Kosten für das Gesundheitswesen von ca. 800 bis 1000 Franken (Anne-Geneviève Bütikofer, Spitalverbands H+).
“Die Schweiz will sich – das scheint der Minimalkonsens von links bis rechts – weiterhin ein hoch qualitatives und halt kostspieliges Gesundheitssystem leisten.”
Das ist richtig und gut so. Halbe Sachen sind am Ende teuer.
Mich stört, dass in der zivilisatorisch hoch stehenden Schweiz, die Bürger offensichtlich nicht in der Lage, nicht fähig sind, ein gesundes Leben zu führen. Ein Grossteil der Kosten entsteht durch die Behandlung von sogenannten Zivilisationskrankheiten. Diese sind vermeidbar. Von Übergewicht im Kindesalter zu Altersdiabetes schon im Jugendalter, bis hin zu weiteren, immer teurer werdenden Kombinationen schon vor dem erreichen des Pensionsalters, ist ein beträchtlicher Teil unserer Bevölkerung im Dauerkrankheitsmodus. Eine verwöhnte, undisziplinierte Gesellschaft hat sich scheinbar damit abgefunden. Da die entstehenden echten Kosten und Aufwände für den Einzelnen gar nicht sichtbar, auch nicht via Portemonnaie fühlbar sind, bleiben die Anstrengungen für ein gesünderes Leben aus.
Mir wird oft entgegengehalten, dass es für wenig Begüterte schwierig ist, gesund zu leben. Gesunde Nahrung, Bewegung, geistige Betätigung und frische Luft aber machen wenig Kosten. Kurz, alle im Gesundheitswesen tätigen müssen den Mut haben nicht nur die Krankheiten zu behandeln sondern alles daran setzen, dass es zu viel weniger Krankheit kommt. Prävention wäre das Zauberwort. Ich weiss, dass sich Wirtschaftskreise dagegen wehren, aber nicht krank werden ist die günstigste Versicherung.
Strahm Ruedi ist einfach Klasse. Er kann mit seinem Wissen und zu den in der vergangenen Legislatur mit den politisch verknoteten Jahren Zusammenhänge aufzeigen. Warum, frage ich mich, polemisiert die breite Stimmbürgerschaft auf den einseitigen Interessens-Argumenten und wählt genau diese wieder? Realität, Begründungen und Argumente zählen kaum bei der breiten Stimmbürgerschaft, dafür aber die polarisierenden “Fakts”.
Ihr erster Satz spricht mir voll aus dem Herzen.
Die Verwaltungskosten, die die Krankenkassen verursachen sind zu hoch. Niemand weiss, welche Kosten durch die Kassen selber generiert werden durch teure Mieten zu viele Kassen, Kosten des Lobiings, exorbitanten Löhne des Kaders, teure Bewirtschaftungen des Vermögens. Unsere Prämien sind zu einem Selbstbedienungsladen verkommen. Mit einem Gesetz, das die Kassen verpflichten würde, nicht mehr als 2 bis max. 5% der Prämieneinnahmen für die Kassenverwaltung zu erhalten, hätten wir die Kosten im Griff. Dadurch würden unsere Prämienzahlungen zu 95 bis 98% für die Gesundheitskosten zur Verfügung stehen.