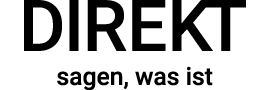Die Credit Suisse ist Geschichte – eine neue Monster-Bank entsteht. Damit erhöht sich das Risiko für eine Wiederholung der Geschehnisse von 2008 und jener vom vergangenen Wochenende. Was muss jetzt geschehen, um eine weitere Finanzkrise zu verhindern? Drei Lösungsansätze im Überblick.
1
Mehr Sicherheit durch höheres Eigenkapital
Eine simple Massnahme für mehr Sicherheit und Stabilität ist die Haltung von mehr Eigenkapital. Heute muss eine Schweizer Grossbank gemäss den Vorgaben der Finanzmarktaufsicht (FINMA) nur über 5 Prozent Eigenkapital verfügen. Viel zu wenig, findet die SP. Sie fordert eine Vorgabe von 20 Prozent hartem Eigenkapital gemäss Artikel 21 der Eigenmittelverordnung. Prominente Unterstützung aus der Wissenschaft hatten die Sozialdemokrat:innen mit dieser Forderung bereits nach der Finanzkrise 2008: Die beiden Wirtschaftswissenschaftler Anat Admati und Martin Hellwig sprechen sich in ihrem Buch «Bankers New Clothes» für ein Eigenkapital von 20 bis 30 Prozent aus. Das erstaunt kaum: Denn wer über mehr Eigenkapital verfügt, hat ein stabileres Polster, insbesondere in Krisenzeiten.
2
Das Trennbankensystem
Was bedeutet eigentlich «too big to fail» (TBTF)? Die FINMA definiert den Begriff so: «Systemrelevante Finanzinstitute können bei einem ungeordneten Ausfall ganze Volkswirtschaften gefährden und gelten deshalb als too big to fail». Seit der Finanzkrise 2008 haben die Verantwortlichen verschiedene Massnahmen ergriffen, um die TBTF-Problematik zu lösen – wie der Absturz der CS und die darauffolgende Rettungsaktion jedoch zeigen, ohne Erfolg. Mehrere Vorstösse von links, die das TBTF-Problem lösen sollten, fielen im nationalen Parlament durch. So auch die Einführung des Trennbankensystems.
Die Sozialdemokratische Fraktion forderte bereits 2013 mit der sogenannten Bankensicherheitsmotion die Einführung eines Trennbankensystems in der Schweiz. Die Motion verlangte die grundsätzliche Trennung der Vermögensverwaltungs- und Geschäftsbanken von den Banken mit Eigenhandel. Nach einer Annahme der Motion im Nationalrat mit Stimmen von SP, Grünen und SVP, scheiterte sie in der kleinen Kammer. Auch der Bundesrat wollte nichts von einem Trennbankensystem wissen. Er anerkannte in seinem Bericht von 2015 zwar, dass organisatorische Massnahmen die Risiken im Zusammenhang mit systemrelevanten Finanzinstituten verringern könnten. Gleichzeitig warnte er vor zu starken Eingriffen in die Finanzmärkte.
Marc Chesney, Finanzprofessor an der Universität Zürich, erklärte 2013 gegenüber der NZZ, dass das Trennbankensystem eine wichtige Massnahme sei, um das System nachhaltig auf Kurs zu bringen.
3
Das Ende der Kultur der Verantwortungslosigkeit
Neben gesetzlichen Anpassungen zur wirksameren Regulierung des Finanzsektors muss auch die Kultur der Unternehmen überdacht werden. Das Magazin ellexx stellt beispielsweise die Frage, ob eine toxische Unternehmenskultur Mitgrund für den Untergang der CS war. Monika Bütler, Ökonomin und Honorarprofessorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen (HSG), antwortet darauf gegenüber ellexx: «In einer interessanten Arbeit wurde nachgewiesen, dass das kulturelle Umfeld der Banken unehrliches Verhalten fördern kann.»
In den letzten zehn Jahren hat sich das Management der Credit Suisse 32 Milliarden Franken an Bonuszahlungen ausbezahlt – trotz bedeutender Verluste. Und selbst nach dem Crash wollte die Bank damit weitermachen, als wäre nichts gewesen. Bisher wollten bürgerliche Politiker:innen nichts von einem Boni-Verbot wissen. Bis zur ausserordentlichen Session bleiben ihre jüngsten Versprechen daher Lippenbekenntnisse.