«direkt»: Herr Tanner, inwiefern ist die neue SVP-Kündigungsinitiative (auch «10-Millionen-Schweiz-Initiative») mit der Schwarzenbach-Initiative aus den 70er-Jahren vergleichbar?
Jakob Tanner: James Schwarzenbach war in den 1930er-Jahren in der «Nationalen Front» aktiv, die in der Schweiz nationalsozialistisches Gedankengut verbreitete. Ende der 1960er-Jahre startete er mit der «Nationalen Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat» seine fremdenfeindliche Volksinitiative. Bis zu 400’000 ausländische Arbeitskräfte hätten bei deren Annahme das Land verlassen müssen. Sie wurde im Juni 1970 mit nur 54 Prozent abgelehnt. Schon damals wurde von einer «10-Millionen-Schweiz» gesprochen.
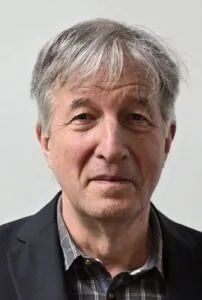
«direkt»: In welchem Zusammenhang?
Jakob Tanner: 1970 legte der St. Galler Wirtschaftsprofessor und Futurologe Francesco Kneschaurek eine Perspektivstudie vor, in der er ein rasantes Bevölkerungswachstum prognostizierte. In Medien und Politik machte umgehend das Schlagwort von der «10-Millionen-Schweiz» die Runde.
«Die SVP-Initiative ist klar antieuropäisch. Wenn die Stimmbevölkerung der Initiative zustimmen würde, wäre dies das Ende der Personenfreizügigkeit.»
«direkt»: Wie hat sich das ausgewirkt?
Jakob Tanner: Gesamtplanung und Zukunftsleitbilder standen stark im Bann dieser Wachstumsperspektive. Es war die Zeit der Fortschrittseuphorie und des Glaubens an einen ewigen konjunkturellen Aufschwung. Schwarzenbach sah darin eine Gefahr. Er hielt Kneschaurek für einen Spinner, der die Schweiz kaputt machen will. Sie sehen: Die Debatte um die 10-Millionen-Schweiz ist nicht neu.
«direkt»: Sind demnach auch die Forderungen der SVP-Initiative nicht neu?
Jakob Tanner: Schwarzenbach verfolgte mit seiner «nationalen Aktion» drei Ziele: Er wollte das «Schweizervolk» vor «Überfremdung» und die schweizerische Landschaft vor Übervölkerung schützen. Zudem wollte er die Schweiz aus dem europäischen Integrationsprozess heraushalten. Vergleichen wir das mit der aktuellen Begrenzungsinitiative, erkennen wir eine starke Überschneidung. Beide Initiativen gaukeln illusorische Problemlösungen vor. Und auch die SVP-Initiative ist klar antieuropäisch. Wenn die Stimmbevölkerung der Initiative zustimmen würde, wäre dies das Ende der Personenfreizügigkeit.
«Schwarzenbach war Vorkämpfer für eine neue fremdenfeindliche Ideologie. Alice Weidel reiht sich rund 60 Jahre später in diese Linie des rechtsextremen Gedankenguts ein.»
«direkt»: Warum wäre das aus Sicht der Initiant:innen erstrebenswert?
Jakob Tanner: Die grossen Arbeitgeber:innenverbände wissen natürlich, dass die Schweizer Wirtschaft sehr stark mit der EU verflochten ist und diese ohne Einwanderung nicht funktionieren würde. Jene, welche diese Initiative unterstützen, wollen die Rechte und auch die Löhne dieser Arbeitsmigrant:innen reduzieren. Zugleich geht es um die Absicherung eines nationalen Geschäftsmodells, das EU-Regulierungen als hinderlich betrachtet. Insbesondere bei der internationalen Vermögensverwaltung und beim Rohstoffhandel. Vertreter:innen dieser Branchen predigen die «Unabhängigkeit» der Schweiz. Darunter verstehen sie das Recht eines kleinen Landes, Geschäfte zu machen, die in der EU mit guten Gründen reguliert und verboten wurden.
«direkt»: Auch andere europäische Länder träumen von Abschottung. In Deutschland sind am 23. Februar Wahlen. War Schwarzenbach der Vorläufer von AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel?
Jakob Tanner: Schwarzenbach war Vorkämpfer für eine neue fremdenfeindliche Ideologie. Das war damals neu für Europa. Er verschob die Grenzen des Sagbaren in Richtung Rassismus und Missachtung von Völkerrecht und Menschenrechten. Alice Weidel reiht sich rund 60 Jahre später in diese Linie des rechtsextremen Gedankenguts ein. Sie hat die AfD in den vergangenen Jahren nochmals nach rechts radikalisiert.
«direkt»: Gibt es noch andere Parallelen?
Jakob Tanner: Wie Schwarzenbach hat auch Weidel einen wirtschaftsliberalen Drive: Der Staat soll zurückgestutzt werden und die Privatwirtschaft mehr Freiraum erhalten. Wie Schwarzenbach vertritt sie ein völlig untaugliches und nicht finanzierbares wirtschaftspolitisches Programm. Schwarzenbach gab sich als «Gentlemen-Politiker», für Weidel ist «Hardlinerin im Businesslook» treffend.
«In der Schweiz, in Deutschland und im übrigen Europa sowie in den USA werden nationalistische und rechtsextreme Positionen in Richtung Mitte verschoben und erscheinen als neues Normal.»
«direkt»: In Deutschland wird oft von der sogenannten Brandmauer gesprochen, welche die demokratischen Institutionen gegen den Rechtsradikalismus schützen soll. Existiert hierzulande auch eine solche Brandmauer?
Jakob Tanner: Die Metapher ist statisch und für die Schweiz wenig tauglich, weil das fremdenfeindliche Narrativ hier von der SVP vertreten wird, die seit langem auf allen Ebenen des Föderalismus etabliert ist. Die SVP ist in Konkordanzregierungen eingebunden, im Bundesrat schon seit fast 100 Jahren. Das unterscheidet sie von der vergleichsweise sehr jungen AfD. Und auch in der Erinnerungskultur positionieren sich die beiden Parteien anders: In Deutschland wird die AfD von einem geschichtsrevisionistischen Lager beherrscht, das Hitler und den Holocaust relativiert, während die SVP stets die vorbildlich neutrale Rolle der Schweiz im Kampf gegen den Nationalsozialismus betont. Sie wehrte sich jedoch beharrlich gegen die Aufarbeitung der Verstrickungen der Schweiz in das NS-Regime und verhält sich damit ebenfalls reaktionär.
«Ganz allgemein gesprochen, geht es um die Verteidigung der Demokratie, die sich eben gerade nicht als ‹völkische Gemeinschaft›, als Kurzschliessung von Volk und Führer begreifen darf, sondern die Menschenrechte hochhalten muss.»
«direkt»: Welche Entwicklungen in der Schweiz sind denn mit jenen in Deutschland vergleichbar?
Jakob Tanner: In der Schweiz, in Deutschland und im übrigen Europa sowie in den USA werden nationalistische und rechtsextreme Positionen in Richtung Mitte verschoben und erscheinen als neues Normal. In der BRD grenzt sich der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz zwar rhetorisch gegen die AfD ab, übernimmt aber inhaltlich deren Forderungen. So wird die Brandmauer zur Farce. Auch in der Schweiz verschiebt sich das politische Gravitationsfeld immer stärker nach rechts.
«direkt»: Haben Sie ein bestimmtes Beispiel im Kopf?
Jakob Tanner: Wenn Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter die antieuropäische Rede des amerikanischen Vizepräsidenten J. D. Vance an der Münchner Sicherheitskonferenz als «Plädoyer für die direkte Demokratie» und als «in gewissem Sinne sehr schweizerisch» bezeichnet zum Beispiel. Das ist eine Anbiederung nach rechts.
«direkt»: Welche Möglichkeiten haben wir in der Schweiz, um gegen den wachsenden Rechtsextremismus anzukämpfen?
Jakob Tanner: Ganz allgemein gesprochen, geht es um die Verteidigung der Demokratie, die sich eben gerade nicht als «völkische Gemeinschaft», als Kurzschliessung von Volk und Führer begreifen darf, sondern die Menschenrechte hochhalten muss. Demokratische Gesellschaften sind auf funktionierende Medien, auf professionellen Journalismus, auf transparente Finanzierung angewiesen.
«Es entsteht der Eindruck, mit nationalen Grenzkontrollen und einer ‹Festung Europa› könnten wir hier endlich im Frieden leben.»
«direkt»: Wo sehen sie die grössten Gefahren für die demokratischen Gesellschaften?
Jakob Tanner: Dass sie an den zentralen Problemen der Gegenwart vorbeipolitisieren und in medial hochgefahrenen Ängsten festfahren. Es geht also darum, die Aufgaben, welche die Politik lösen soll, demokratisch zu bestimmen. Das ist in einer medialen Öffentlichkeit, die gerade unter der Kontrolle von grossen Tech-Konzernen umgebaut wird, schlecht möglich. Das Manipulationspotential, das zynischerweise «Meinungsfreiheit» genannt wird, ist sehr gross. Der Politik muss es gelingen, diese Tech-Giganten als Medienkonzerne zu behandeln, sodass sie entsprechend reguliert werden können.
«direkt»: Der Klimawandel scheint die Menschen nicht halb so fest zu bewegen wie die Migration.
Jakob Tanner: Ja, es gibt eine klare Fokussierung auf die Zuwanderung. Schreckliche Ereignisse werden medial so stark in den Mittelpunkt gerückt, dass sie alles andere überstrahlen. Es entsteht der Eindruck, mit nationalen Grenzkontrollen und einer «Festung Europa» könnten wir hier endlich im Frieden leben. Angesichts der Tatsache, dass europäische Länder heute Einwanderungsgesellschaften sind, ist das eine verzerrte Wahrnehmung, die auch den Blick auf die Klimakrise verstellt.
«direkt»: Was können wir dagegen tun?
Jakob Tanner: Die Frage ist, welche politischen Kräfte über die Definitionsmacht verfügen. Sind es jene, die den ökologischen Umbau der Wirtschaft vorantreiben, die soziale Ungleichheit bekämpfen, sich konstruktiv mit neuen Technologien auseinandersetzen – oder sind es populistische Parteien, die alle diese Probleme ausblenden und ihre Kampagnen auf Ressentiment, Fremdenhass und Diskriminierung aufbauen. Eine demokratische Politik, die auf Wissen basiert und wissenschaftliche Erkenntnisse ernst nimmt, ist sehr anspruchsvoll. Wir dürfen dieses Projekt aber nicht aufgeben. Ich bin für einen illusionslosen Optimismus, der Widersprüche nicht überspielt.






Sehr geehrter Hr. Dr. Tanner.
Als ehemaliger Student an der UNI Bern danke ich für den Artikel, möchte aber doch noch etwas anfügen, dass für mich im Kampf gegen den Rechtsextremismus entscheidend ist und dass wäre die Verteidigung der Gewaltentrennung und da besonders die Unantastbarkeit der Judikative.
Die Machtfantasien rechtsextremer Politik zielen immer darauf die Gerichte unter Kontrolle zu bringen und so gesehen legte King Trump den Grundstein für sein jetziges Handeln in der ersten Amtszeit mit der Besetzung des Obersten Gerichts. Die von ihm bestellten Richter bedankten sich dafür mit einem Ermächtigungsurteil, dessen Konsequenzen noch nicht absehbar sind.
Ich wäre froh, Ihren illusionslosen Optimismus zu teilen, aber was ich heute sehe, erinnert mich sehr an München 1938, wobei der Trump-Putin-Pakt ja vielleicht schon telefonisch vorgezogen wurde? Das Resultat solcher Appeasement-Politik kennen wir aber alle zur genüge und sich der Anfänge zu erwehren, ist offensichtlich auch schon viel zu spät. Den einzigen Schutz, den wir noch geniessen und der ein wenig optimistisch stimmt, ist auch wie 1939; welcher Dieb greift schon seine eigene Bank an? 😉
Mit freundlichen Grüssen, Samuel B. Balmer
Eine Frage: welches sind finanzstarke Wirtschaftskräfte in der Schweiz, welche ebenfalls ein eigenes Interesse haben und bekunden, die Gefahren der „Begrenzungsinitiative“ der SVP wahrzunehmen und diese Initiative zu bekämpfen?
Wir sollten dem Freiheitsmythos der Rechten eine Haltung der Verantwortung entgegenstellen. Make America great again ist keine Haltung der Verantwortung sondern die des ausschliesslichen Eigennutzes. Ich denke, dass Verantwortung ein stärkeres Fundament abgibt als Menschenrechte obwohl diese selbstverständlich dazu gehören. Leider ist schon bei der Aufklärung mit der Égalité, Liberté und Fraternité die Verantwortung etwas zu kurz gekommen.
Wir die Schweiz gehört nun einmal zu Europa. Aber auch ich bin gegen enen EU beitritt.
Aber wir sollten die iniative klar ablehnen und auch zeigen dass wir zu Europa gehören.
Ich bin auch der Meinung, auch wenn wir nur Kapitalistische Politiker haben die auch Trump
in den Arsch kriechen um noch mehr Geld zu gewinnen. Wir müssen uns langam aber sicher von Amrika distanzieren, jedenfalls so lange Trump am Ruder ist.
Ich will meinen Kommentar kurz halten. Im Prinzip wäre ich auch für eine Einwanderung im engeren Rahmen. Aber was da abgeht in den USA mit der gewählten Regierung unter Trump und den rechtsextremen Europäern (Weidel,Le Pen,Orban usw.) ist eine Schande! Menschenverachtender, nur gewinnorientiert für die Reichsten, da müssen wir Demokraten entgegenhalten. Zur Ukraine: Was da sich abzeichnet ist ein grosser Verrat der demokratisch gewählten Regierung Selensky gegenüber. Sehr beunruhigend. Trump mit seiner vergifteten Riege gehören auf den Misthaufen der Geschichte. Diese toxische Truppe sind Verräter der europäischen Sache im höchsten Grade. Unsere Bundesprädentin K. Keller,Sutter weiss auch nichts besseres, als diesem Gift z.T. noch zu huldigen. Aber auch da, das rücksichtslose Geschäfte-Machen kommt bei der SVP und teilweise bei der FDP vor der Moral.
Viele… besorgte…freundschaftliche Grüsse
Hansjörg Hengartner
Grenchen
Ich kann dem Kommentar von Hr.Tanner nur zustimmen
Wir brauchen keine SVP.
Mit freundlichen Grüssen
Khalilzad zalmay
Erste stelle ist Menschen rechts und mit Welt zusammen arbeiten. Schweiz gut zu führen
Mit europäischen Ländern gute kontak zu haben.
Das Interview mit Jakob Tanner ist sehr aufschlussreich und bestätigt mir die verbalen und handgreiflichen Angriffe von RECHTS an der gestrigen Demo (Sa. 22.2.25 14:00-14:45) gegen Alice Weidel in Einsiedeln.
Für mich mit JG 1946 unbegreifliche Vorgänge im rechten politischen Lager.
So gesehen gab mit Jakob Tanner Mut weiter dagegen zu halten.
Ganz herzlichen Dank und ein Bravo zu diesem Interview.
Benno Lehner-Boog, SP Schmerikon-Eschenbach SG
Jakob Tanner setzt die richtigen Akzente gegen eine emotionalisierte Beschreibung der Realität durch von privaten Interessen gesteuerte Populisten. Der Sinn für ein Miteinander von allen in Staat und Wirtschaft wirkenden Einwohnerinnen und Einwohner wird gegenwärtig gezielt geschwächt – als ob eine auf Abgrenzung setzende Apartheidgesellschaft zukunftsfähig wäre.
Ich schätze sehr dass Herr Tanner bezug nimmt auf die damalige Politik von Herrn Schwarzenbach und auch auf die heutige Politik von Frau Weidel in Deutschland. Seine Meinung zu den beiden teile ich voll und ganz. Ich selber habe Jahrgang 1938
Den vorgebrachten Argumenten kann ich durchaus zustimmen.
Leider gibt es aber auch gute Argumente gegen eine 10-Millionen-Schweiz: Schon heute überfordern wir mit unserem Lebensstil und einer Bevölkerung von 9 Millionen unsere Umweltkapazität um nindestens das Vierfache. Und mit jedem zusätzlichen Menschen verschlechtert sich dieses Verhältnis weiter.
Zusätzlich zu den Schaltstellen Energiesparen, Verminderung des Ressourcenverbrauchs, Reduktion der Mobilität, vernünftige Ernährung u.a. ist die Schrumpfung der Bevölkerung ein ebenso wichtiger Faktor. Es geht also nicht um wieviel mehr, sondern wie werden wir weniger!
Das hat dann notabene nichts mit Herkunft oder Nationalitäten, sondern ausschliesslich mit der Anzahl Menschen an sich zu tun.
Ich bin wie Hr. Hengartner der festen Überzegung, dass alle Demokraten sich wehren müssen gegen die beabsichtigte u zum Teil leider schon weit gediehene Demontage der Demokratie, vorallem in den USA, in Ostdeutschland, in Ungarn, in der Slowakei, in der Türkei, in Russland, in Aserbaidschan usw. U in der Schweiz sind wir mit den extremrechtsbürgerlichen faschistoiden Parteien SVP, FDP u Mitte auch schon dabei, die Demokratie soweit einzuschränken, dass diese Parteien weit mehr Schaden an der Gesellschaft u der Volkswirtschaft anrichten als bisher u dabei nicht mehr genügend von lästigen unabhängigen Medien kritisiert werden, um die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen. Diesem Ziel dient ja auch die ‚Halbierungsinitiative‘, von derselben undemokratischen u faschistischen SVP lanciert wie die 10 Mio.initiative. U BP Keller-Suter offenbart mit ihrem Lob für die Rede von J.D. Vance an der smc in München, dass sie dieselbe rechtsextreme, undemokratische u faschistische Linie wie die Republikaner in den USA vertritt. Nur Faschisten hegen Sympathien für Faschisten. Denn wenn sie eine Demokratin wäre, hätte sie der Rede von Vance entschieden u in aller Form widersprechen müssen. Weit haben wir’s gebracht !
Es ist jetzt wichtig, dass wir das neue Rahmenabkommen mit der EU ratifizieren und die SVP Initiative erfolgreich bekämpfen. Wir müssen aufpassen dass wir Kapitalismus mit Rechtsradikalismus verknüpfen und uns ( die SP ) als die Besserwisser und Beschützer des „heiligen Grals“ positionieren. Ich möchte allen zurufen weiter für die Demokratie mit Eigenverantwortung einzustehen.
10’000’000 Schweiz, wann ist genug und wann zuviel? 15; 20; 30 Milionen? Ist man ein Rechtsextremer wenn man sich um Heimat und Natur Sorgen macht? Da unser zu schnelles Bevölkerungswachstum nicht hausgemacht sondern importiert ist wird ein Bremsen natürlich sofort „fremdenfeindlich“. Herr Tanner, jetzt wo wir neue Lösungen finden müssen wollen Sie weitermachen wie gehabt. Leider zeigen Sie nichts was mir für die Zukunft meiner Enkel Mut machen würde. Die Schweiz wächst nicht, auch die Erde vergrössert sich nicht. Wir verbrauchen jetzt schon ein Vielfaches der uns eigentlich zustehenden Resourcen. Ich bin dafür zu bremsen, auch wenn mich dies in Ihren Augen zum Rechtsextremisten abstempelt.