Gemeinsam mit 14 weiteren Jugendlichen habe ich im Herbst 2022 meinen Ausbildungsweg in der Berufsschule gestartet. Drei Jahre lang haben wir dort den Beruf erlernt, den wir uns ausgesucht haben. Einen Beruf, auf den wir uns gefreut haben. Wir waren motiviert, voller Energie, und viele von uns hatten das Gefühl, eine sinnvolle Aufgabe gefunden zu haben. Einmal hat unsere Lehrerin uns gefragt: Wer von euch will nach der Ausbildung wirklich als Fachperson Betreuung weiterarbeiten? Eine einzige Hand streckte nach oben. Überrascht hat mich das nicht – und doch war es ernüchternd. Nur eine einzige Person aus unserer Klasse wollte bleiben. Auch ich habe meine Hand unten gelassen. Ein Beruf, der händeringend nach Personal sucht – nach motiviertem, gut ausgebildetem Personal. Und trotzdem will fast niemand bleiben. Es überrascht mich nicht – und trotzdem frage ich mich: Warum?
System auf der Kippe
Warum steigt man aus einem Beruf aus, den man sich einmal mit Überzeugung ausgesucht hat? Es liegt nicht daran, dass meine Klassenkamerad:innen und ich keine Freude an der Arbeit mit Kindern hätten – im Gegenteil. Aber die Realität hält oft nicht, was die Ausbildung verspricht: tiefe Löhne, hoher Druck, kaum Wertschätzung. Das treibt viele von uns raus. Und genau das bringt ein ganzes System ins Wanken.
«Eine Kita, die ständig auf Reserve läuft, kann weder den Kindern noch den Mitarbeitenden gerecht werden.»
Ein Blick auf die Zahlen bestätigt diesen Eindruck. Laut Kibesuisse, dem Dachverband der Kinderbetreuung, steigen rund 30 Prozent der ausgebildeten Fachpersonen Betreuung nach der Ausbildung oder in den ersten Berufsjahren wieder aus. Das ist eine dramatische Zahl: Jede dritte Person verlässt ein Berufsfeld, das unsere Gesellschaft dringend braucht. Zum Vergleich: In der Pflege, die ebenfalls mit chronischem Fachkräftemangel kämpft, liegt die Austrittsquote bei etwa 20 Prozent. Wir sprechen hier also von einer viel höheren Belastung in einem Bereich, der eigentlich die Grundlage für Gleichstellung, Vereinbarkeit und frühkindliche Bildung bildet. Können wir uns das leisten? Eigentlich nicht.
Chronischer Fachkräftemangel
Die Folgen sind in den Kitas spürbar. Laut einer Umfrage von Kibesuisse haben 95 Prozent aller Kitas mindestens eine Stelle unbesetzt. Fast jede Einrichtung arbeitet also mit zu wenig Personal. Das bedeutet: Die Fachpersonen, die bleiben, müssen noch mehr auffangen. Krankheitsausfälle? Werden kompensiert, indem Gruppen zusammengelegt werden. Diese Personalausfälle wiederum werden durch Lernende oder Praktikant:innen kompensiert. Das führt zu einer Belastungsspirale: Wer bleibt, wird immer stärker gefordert, und die Gefahr, selbst auszusteigen, wächst. Eine Kita, die ständig auf Reserve läuft, kann weder den Kindern noch den Mitarbeitenden gerecht werden.
Und genau hier zeigt sich, wie sehr der Fachkräftemangel die Qualität trifft. Eine Rückmeldung, die ich kürzlich auf einen Aufruf auf Instagram erhalten habe, bringt es auf den Punkt: «Es ist echt krass, wie viel wir leisten müssen in dieser knappen Zeit. In meiner Kita waren wir oft mit 15 bis 16 Kindern in einer Gruppe und nur Lernende oder Praktikant:innen vor Ort. Da bleibt so viel auf der Strecke. So kann man die Kinder nicht so begleiten, wie sie es verdient hätten.» Diese Stimme zeigt, was viele erleben: Wenn zu wenig Personal da ist, bleibt nicht nur weniger Zeit, es sinkt die Qualität insgesamt. Ein Konzept, das auf dem Papier «pädagogisch hochwertig» klingt, kann im Alltag nicht umgesetzt werden, wenn schlicht die Leute fehlen.
«Es fehlt nicht am Herzblut der Menschen, sondern an guten Rahmenbedingungen. Wer ständig Überlastung, fehlende Unterstützung und mangelnde Wertschätzung erlebt, verliert die Kraft, weiterhin in diesem Beruf zu arbeiten.»
Qualität sinkt
Eine weitere Rückmeldung, die mich erreicht hat, zeigt, wie sehr der Personalmangel die Bedingungen verschärft und sogar krank macht. Eine ehemalige Fachperson schrieb mir, dass sie als Ausgebildete neben der Kinderbetreuung sämtliche Büroarbeiten und gruppenübergreifende Aufgaben erledigen musste. Krankheitsausfälle seien überhaupt nicht gern gesehen gewesen, obwohl man in einem Umfeld arbeite, in dem es fast unmöglich ist, gesund zu bleiben. Über Jahre sei sie ständig krank gewesen und habe sich kaum je erlaubt, zu Hause zu bleiben. Seit sie nicht mehr in der Kita arbeitet, sei sie kein einziges Mal krank gewesen. Hinzukomme, dass sie viele Leitungen erlebt habe, die wenig sozial kompetent waren. Die Arbeit mit den Kindern und Eltern habe sie zwar geliebt – aber unter diesen Bedingungen habe sie sich gegen den Beruf entschieden.
Diese Rückmeldung macht deutlich: Es fehlt nicht am Herzblut der Menschen, sondern an guten Rahmenbedingungen. Wer ständig Überlastung, fehlende Unterstützung und mangelnde Wertschätzung erlebt, verliert die Kraft, weiterhin in diesem Beruf zu arbeiten. Fachkräftemangel ist deshalb nicht nur eine Zahl in einer Statistik – er bedeutet konkret sinkende Qualität, steigende Belastung und letztlich den Verlust von motivierten Fachpersonen.
Mangelnde Unterstützung
Ein weiteres Beispiel, das mir geschildert wurde, zeigt die Folgen sehr deutlich: In einer Kita wurde plötzlich entschieden, eine neue Gruppe zu eröffnen – obwohl bereits massiver Personalmangel herrschte. Sieben oder acht Eingewöhnungen wurden angesetzt, obwohl das Team schon am Limit war. Eine neu eingestellte Person, die sich eigentlich als Miterzieher beworben hatte, wurde gleich am ersten Tag als Gruppenleitung eingesetzt – ohne Einführung, ohne das Konzept zu kennen. Er musste zwei bis drei Eingewöhnungen pro Tag übernehmen, war völlig überfordert und bekam kaum Unterstützung, weil das Team selbst am Anschlag war. Am Ende wurde er krankgeschrieben und kündigte. Die neue Gruppe wird nun bald wieder geschlossen, die frisch eingewöhnten Kinder auf andere Gruppen verteilt. Dieses Beispiel zeigt: Fehlendes Personal führt nicht nur zu Stress im Team, sondern direkt zu Brüchen in der Betreuung der Kinder. Am Ende spüren es immer die Kinder – sie verlieren ihre Bezugspersonen, und pädagogische Konzepte bleiben auf der Strecke.
Hinzu kommt eine weitere erschreckende Zahl: Nur 45 bis 49 Prozent des Kita-Personals in der Schweiz haben überhaupt eine abgeschlossene Ausbildung. Das heisst: Jede zweite Betreuungsperson ist nicht ausgebildet. Ich kenne Kitas, in denen eine einzige ausgebildete Fachperson Betreuung arbeitet – und rundherum Lernende, Praktikant:innen oder Quereinsteiger:innen. Natürlich leisten auch sie wertvolle Arbeit. Aber ist das die Qualität, die wir uns für die Betreuung und Bildung unserer Kinder wünschen? Kinder brauchen Bezugspersonen, die bleiben und fachlich kompetent sind. Wenn die Fluktuation hoch ist und ständig neue Gesichter da sind, leidet nicht nur die Qualität, sondern auch die emotionale Sicherheit der Kinder.
«Die Konsequenzen tragen nicht nur die Beschäftigten, sondern die ganze Gesellschaft. Für Kinder bedeutet es wechselnde Bezugspersonen und weniger pädagogische Qualität. Für Eltern bedeutet es weniger verfügbare Plätze und höhere Kosten. Für die Wirtschaft bedeutet es, dass viele Elternteile – meistens Mütter – ihr Pensum reduzieren müssen, weil sie keine verlässliche Betreuung finden.»
Tiefe Entlöhnung
Wer im Beruf bleibt, arbeitet oft unter schwierigen Bedingungen. Der Medianlohn für eine Fachperson Betreuung in der Stadt Zürich liegt bei rund 64’400 Franken brutto für ein 100-Prozent-Pensum mit 42 Wochenstunden. Viele arbeiten jedoch Teilzeit – nicht freiwillig, sondern weil es kaum möglich ist, Familie und die hohe Belastung in einem Vollpensum zu vereinbaren. Wer 60 oder 70 Prozent arbeitet, verdient entsprechend weniger und kommt gerade so über die Runden. Besonders bitter ist das für jene, die selbst Kinder haben: Sie betreuen täglich fremde Kinder – und können sich die Kita für die eigenen kaum leisten. Dieses Paradoxon ist im Alltag vieler Fachpersonen Realität.
«Wenn wir nicht endlich bessere Arbeitsbedingungen schaffen, wenn wir nicht endlich faire Löhne zahlen und Fachkräfte im Beruf halten, dann wird das Fundament unseres Betreuungs- und Bildungssystems brüchig.»
Neben der finanziellen Belastung ist da auch die fehlende Anerkennung. In der Ausbildung wird uns vermittelt, wie wichtig frühkindliche Bildung ist, wie sehr die ersten Lebensjahre die Entwicklung prägen. In der Realität aber wird die Arbeit in der Kita noch immer oft als «Aufbewahrung» gesehen – als Dienstleistung, damit die Eltern arbeiten gehen können. Das entspricht weder der Verantwortung noch den Fähigkeiten, die Fachpersonen täglich einbringen. Diese fehlende gesellschaftliche Wertschätzung verstärkt das Gefühl, dass der Beruf auf Dauer nicht tragbar ist.
Gesamtgesellschaftliche Verantwortung
Die Konsequenzen tragen nicht nur die Beschäftigten, sondern die ganze Gesellschaft. Für Kinder bedeutet es wechselnde Bezugspersonen und weniger pädagogische Qualität. Für Eltern bedeutet es weniger verfügbare Plätze und höhere Kosten. Für die Wirtschaft bedeutet es, dass viele Elternteile – meistens Mütter – ihr Pensum reduzieren müssen, weil sie keine verlässliche Betreuung finden. Damit wird die Gleichstellung blockiert und das Potenzial vieler Familien nicht genutzt. Volkswirtschaftlich ist das fatal: Studien zeigen seit Jahren, dass jeder in die frühkindliche Bildung investierte Franken mehrfach zurückkommt. Doch ohne die Menschen, die diese Arbeit leisten, bleibt das eine leere Rechnung.
Wenn wir nicht endlich bessere Arbeitsbedingungen schaffen, wenn wir nicht endlich faire Löhne zahlen und Fachkräfte im Beruf halten, dann wird das Fundament unseres Betreuungs- und Bildungssystems brüchig. Die Geschichten von überforderten Teams, kranken Fachpersonen und geschlossenen Gruppen zeigen, dass der Fachkräftemangel nicht abstrakt ist – er zerstört Qualität, Kontinuität und Vertrauen in die Betreuung. Die Kita-Initiative, über die wir nächstes Jahr abstimmen, setzt genau hier an. Sie will nicht nur die Kosten für die Eltern senken, sondern auch die Bedingungen für die Fachpersonen verbessern. Denn gute Qualität gibt es nur, wenn die Menschen, die diese Arbeit leisten, bleiben können.
Deshalb müssen wir uns fragen: Wollen wir, dass Kitas Orte sind, an denen Kinder wirklich gefördert, Eltern entlastet werden und Fachpersonen mit Stolz und Sicherheit ihren Beruf ausüben? Oder wollen wir zusehen, wie immer mehr von uns den Beruf verlassen – bis irgendwann nichts mehr geht? Die Antwort liegt auf der Hand. Doch ob wir sie politisch umsetzen, wird sich erst noch zeigen.
Jascha Harke ist Mitglied der Geschäftsleitung der SP Zürich und arbeitet in einer städtischen Tagesschule in der Betreuung. Harke kandidiert im März für den Zürcher Gemeinderat. Im Zentrum stehen die Bildung und Wohnpolitik.
Die Kolumne ist eine «Carte Blanche» und widerspiegelt die Meinung der Autor:in.





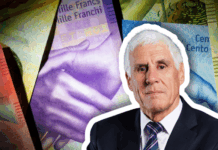
Beginnt doch bitte damit, den Personalschlüssel anzupassen damit man genügend Zeit hat die administrativen Arbeiten und das Ausbilden von Lernenden nebenbei qualitativ gut erfüllen und umsetzen zu können!