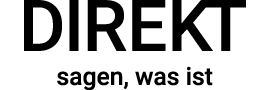Oft habe ich mich gefragt, wie es sein kann, dass Frauen rechte Parteien wählen – obwohl die Programme rechter und rechtsextremer Parteien weiblichen Interessen ganz offensichtlich zuwiderlaufen. In Didier Eribons Buch Rückkehr nach Reims gibt es dazu eine aufschlussreiche Passage: Er spricht seine Mutter darauf an, dass sie Marine le Pen gewählt hat. Deren Partei ist gegen das Recht auf Abtreibung, dabei hat Eribons Mutter doch selbst einmal abgetrieben. Die Antwort der Mutter: «Das ist was anderes, deswegen habe ich die doch nicht gewählt.»
Frauen, die rechte Parteien wählen, ist offenbar sehr wohl bewusst, dass sie damit Möglichkeiten abwählen, die sie selbst für sich beanspruchen. Etwa das Recht, eine Schwangerschaft abbrechen zu können. Sie wählen trotzdem rechts. Und mehr noch: Viele empfinden diese Wahl sogar als emanzipatorisch und ermächtigend.
Warum entscheiden sich viele Frauen sehenden Auges für ihre eigene Benachteiligung?
Die Antwort darauf ist komplex, und dieser Text kann nur Anhaltspunkte geben und keine abschliessenden Thesen. Aber die Frage ist dringlich. Denn immer mehr Frauen wählen rechts – und sie machen auch beachtliche Karrieren in rechtspopulistischen Parteien oder als rechte Influencerinnen. Gleichzeitig gilt: In Europa wählen weiterhin insgesamt weniger Frauen als Männer rechts (mit Ausnahme Frankreichs). Vor allem junge Frauen wählen deutlich häufiger grüne oder linke Parteien als junge Männer – auch in der Schweiz. Frauen sind also keine einheitliche Gruppe, sondern stehen für unterschiedliche, teils widersprüchliche Phänomene gleichzeitig: Viele repräsentieren Progressivität – andere unterstützen reaktionäre Bewegungen.
«Die Realität vieler Frauen unter spätkapitalistischen Bedingungen sieht also anders aus, als es moderne Emanzipationsideale nahelegen. Der Druck der individuellen Erfolgsansprüche lässt sie oft erschöpft zurück – ihre Lebensbedingungen geben ein freies und selbstbestimmtes Leben einfach nicht her.»
Emanzipationsverdrossenheit
Man wird dem Phänomen rechter Frauen nicht gerecht, wenn man ihre rechte Positionierung ausschliesslich aus einer liberal-feministischen Perspektive betrachtet – also aus der Annahme heraus, diese Frauen handelten «gegen ihre Interessen». Die aktuelle Forschung zeigt, dass viele der so genannten westlichen Emanzipationsideale für zahlreiche Frauen in der Praxis weder erreichbar noch realistisch erscheinen. Viele Frauen können sich ein Leben unabhängig von Männern schlicht nicht leisten. In zahlreichen weiblichen Lebensentwürfen sind schlecht bezahlte Erwerbsarbeit, die Verantwortung für Kinder und Angehörige sowie die Dominanz von Männern so prägend, dass feministische Ideale kaum eingelöst werden können. Das gilt auch für privilegierte Frauen: Gerade in den gesellschaftlichen Funktionseliten, also in den Berufsgruppen Betriebswirtschaft, Jura und MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sind Sexismus, Antifeminismus und Neokonservatismus weit verbreitet und werden als aktives Machtinstrument gegen den Aufstieg und die Teilhabe von Frauen eingesetzt.
Die Realität vieler Frauen unter spätkapitalistischen Bedingungen sieht also anders aus, als es moderne Emanzipationsideale nahelegen. Der Druck der individuellen Erfolgsansprüche lässt sie oft erschöpft zurück – ihre Lebensbedingungen geben ein freies und selbstbestimmtes Leben einfach nicht her. Aus dieser Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit erwächst nicht selten eine Art Emanzipationsverdrossenheit.
Und genau hier setzen rechte Programme erfolgreich an. Sie greifen weibliche Erfahrungen von Überlastung, Kränkung und Scheitern auf und bieten entlastende Deutungen. Die Überforderung kann in Hass auf andere ausgelagert werden: auf Migrant:innen, Geflüchtete, trans Menschen oder Feminist:innen. Rechte Angebote ermöglichen es so, die Erfahrung des Scheiterns durch Gefühle von vermeintlicher Überlegenheit und Stärke zu kompensieren.
Politik der Paradoxien
Rechte Akteur:innen haben früh erkannt, welch gewaltiges Mobilisierungspotenzial das Thema Geschlecht besitzt – nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen. Kaum ein anderes Feld ist so eng mit persönlichen Erfahrungen, Identitäten und Emotionen verwoben. Fragen von Geschlecht betreffen intime Beziehungen ebenso wie Arbeit, Sprache oder Elternsein. Geschlecht eignet sich als wirkmächtiges politisches Kampfmittel, weil damit unterschiedliche soziale Gruppen auf emotionaler Ebene erreicht werden. Geschlecht wird als eine Art «symbolic glue» (symbolischer Kitt) eingesetzt, der eine gemeinsame Empörung in unterschiedlichen politischen Lagern ermöglicht, diese verbindet und Teile der gesellschaftlichen Mitte anti-egalitär einstimmt.
Auch die Mobilisierung von Frauen im rechten Projekt ist kein Zufall. Obwohl Männer in den entsprechenden Parteien weiterhin klar dominieren, stehen Frauen wie Marine Le Pen in Frankreich, Kristi Noem in den USA oder Alice Weidel in Deutschland oft im Rampenlicht. Sie verleihen, wie Gabriele Dietze zeigt, rechtsextremen Positionen ein ansprechenderes, vermeintlich harmloses Gesicht und verkörpern durch ihre Präsenz Modernität und Fortschrittlichkeit.
Diese Politikerinnen argumentieren gegen Frauen- und LGBTIQ-Rechte, nehmen aber die Errungenschaften dieser Gruppen durchaus für sich in Anspruch, etwa die Möglichkeit, offen lesbisch zu leben, eine Karriere in der Politik zu machen, sich von einem toxischen Ehemann zu trennen usw. Ihre Politik und ihr Auftreten basieren auf einer paradoxen Mischung aus Traditionalismus und weiblicher Freiheit.
«Der grösste Erfolg rechter Geschlechterpolitik der vergangenen zehn Jahre besteht vermutlich darin, Gleichstellung, Feminismus und Emanzipation erfolgreich als Bedrohung zu rahmen: als Zwang, als ideologische Umerziehung ‹von oben›.»
Die Politikwissenschaftlerin Cornelia Möser bezeichnet dieses Spannungsverhältnis als «Politik der sexuellen Paradoxie». Sie kennzeichnet nicht nur rechte Frauen, sondern die rechte Geschlechterprogrammatik insgesamt: Zum Beispiel feiert diese Programmatik die «abendländische» Gleichstellung, und proklamiert zugleich eine neue weibliche Häuslichkeit. Rechte Akteur:innen mobilisieren gegen die «Ehe für alle», und betonen gleichzeitig die Emanzipation von sexuellen Minderheiten und von Frauen, wenn es darum geht, Migration als Gefahr zu politisieren. Diese Rhetorik attackiert also genau jene Modernität, die sie gleichzeitig als «westliche Werte» verteidigt.
Die Faschismusforschung weist seit Jahrzehnten darauf hin, dass rechte Politik nie auf inhaltliche Kohärenz zielte. Widersprüchlichkeit, Paradoxie und strategische Mehrdeutigkeit bilden vielmehr zentrale Erfolgsbedingungen. Das Pendeln zwischen Traditionalismus und Freiheitsrhetorik ist daher kein Unfall, sondern ein historisch stabiles Merkmal rechter Geschlechterpolitik, die es möglich macht, äusserst unterschiedliche Milieus gleichzeitig anzusprechen.
Der grösste Erfolg rechter Geschlechterpolitik der vergangenen zehn Jahre besteht vermutlich darin, Gleichstellung, Feminismus und Emanzipation erfolgreich als Bedrohung zu rahmen: als Zwang, als ideologische Umerziehung «von oben». Viele Menschen verstehen Geschlechtergerechtigkeit heute nicht mehr als demokratisches Projekt, sondern als elitäres Vorhaben, das angeblich gegen die Lebensrealitäten «einfacher Menschen» gerichtet ist.
Die Umdeutung von Gleichstellung als «Eliteprojekt» wirkt auch bei Frauen. Besonders eben bei jenen, für die Geschlechtergleichheit ohnehin wenig realistisch ist, die unter der Mehrfachbelastung von Carearbeit und Job ächzen. Für viele ist daher das Angebot attraktiv, traditionelle Weiblichkeit aufzuwerten und zumindest symbolische Anerkennung für das zu erhalten, was sie dauernd leisten: den Grossteil der Carearbeit.
Die rechte Geschlechterpolitik proklamiert eine neue – scheinbar aufgewertete – sorgende Mütterlichkeit, sie macht die traditionelle Familie zur letzten Bastion von Liebe, Sinn und Geborgenheit. Und gleichzeitig wird die Familie zum Hort des Widerstands erklärt, zum Widerstand gegen «die Eliten», gegen eine grausame, vereinzelnde, unsolidarische Welt.
Die alt-neue Weiblichkeit der «Tradwives»
Birgit Kelle, eine prominente deutsche Antifeministin, wandte sich schon vor vielen Jahren vehement gegen das, was sie als «emanzipatorischen Zwang» versteht, und reklamierte die Hausfrauenrolle als Form des Widerstands: «Ich habe es satt, mich schlecht zu fühlen wegen der Tatsache, dass ich kein Problem (…) mit meinem Mann habe, der die Familie ernährt; mich schlecht zu fühlen, weil ich ‹nur› Hausfrau und Mutter bin (…).»
Dietze beschreibt diese Positionierung als eine «retrotopische Vision von Weiblichkeit», die «alt» zu «neu» aufpoliert. Besonders die so genannten Tradwives präsentieren heute in den sozialen Medien mit grosser Reichweite eine solche alt-neue Weiblichkeit. «Tradwives» (kurz für traditional wives) sind Frauen, die ein strikt traditionelles Rollenbild propagieren. Das Phänomen entstand in den USA ab Mitte der 2010er-Jahre, zunächst in Blogs, später auf Instagram, YouTube und TikTok. Ideologisch speist sich die Bewegung aus christlichem Konservatismus und zunehmend auch aus rechtspopulistischen und rechtsextremen Milieus. Die «Tradwives» inszenieren traditionelle Mütterlichkeit als Befreiung von mühseligen Aushandlungen über die Verteilung von Carearbeit, wie Dietze weiter ausführt. Tradwives berufen sich auf eine idealisierte Vergangenheit, in der Frauen sich für Familie und Ehemann aufopferten. Gleichzeitig verpacken sie genau das als «neue Modernität», denn sie sind fest in der neoliberalen «personal choice»-Ideologie verankert. Der Traditionalismus ermöglicht ihnen paradoxerweise einen gewissen Freiheitsgrad und Handlungsspielräume: Er wird als selbstbestimmte, frei gewählte Alternative zu Feminismus und Emanzipation inszeniert – und verschafft den Tradwives millionenfache Reichweite.
Tradwives sind zu einem zentralen symbolischen Kapital rechter Bewegungen geworden. Ihre Lebensentwürfe gelten als «Wahl» der «einfachen Menschen» gegen die «Gender-Eliten». Indem die traditionelle Familie als «mutig» inszeniert wird, verkehrt sich die Idee widerständigen Handelns: Nicht die Befreiung von Geschlechternormen gilt als revolutionär, sondern die Rückkehr zur Kleinfamilie.
«Der Faschismus ent-diabolisiert sich in der Tradwife-Maskerade und wird in einer rosafarbenen Kochrezepte-Variante breiter annehmbar.»
Viele Tradwives stellen weibliche Gefügigkeit auch in den Dienst einer rassistischen Bevölkerungspolitik. So verbindet etwa Ayla Stewart das Ideal der Häuslichkeit mit einer sogenannten «white baby challenge» gegen das vermeintliche «Aussterben» der weissen Bevölkerung. Auch die AfD fordert eine höhere Fruchtbarkeit «biodeutscher» Frauen und betont deren angeblich natürliche Fürsorgefähigkeit. Das «Sich-Kümmern» wird zum sich kümmern um das eigene Volk. Weibliche Fürsorglichkeit formiert sich als militante Verteidigung von Familie und Nation gegen die «Fremden».
Tradwives transportieren selbstbewusst die Ideologien der Rechten und verpacken sie in sanfter Häuslichkeit. In der Rolle der «sorgenden Mütter» werden sie nicht als Verbreiterinnen von Hass wahrnehmbar. Der Faschismus ent-diabolisiert sich in der Tradwife-Maskerade und wird in einer rosafarbenen Kochrezepte-Variante breiter annehmbar.
Angebot der Aufwertung
Der rechte Geschlechterkosmos eröffnet Frauen alternative Formen der Anerkennung jenseits von liberalen oder linken Emanzipationsangeboten. Regressive Rollenbilder werden als Rebellion gegen ein «elitäres System» inszeniert und bieten, wie die Kulturwissenschaftlerinnen Agnieszka Graff und Elżbieta Korolczuk ausarbeiten, eine konservative Antwort auf die erschöpfenden Auswüchse des Neoliberalismus. In einer entsolidarisierten Profitgesellschaft wird weibliche Fürsorglichkeit zum letzten Reservoir der Geborgenheit. Da sich in der Verteilung von Carearbeit bis heute so gut wie nichts verändert hat und Frauen diese ohnehin tragen, glauben Frauen verständlicherweise oft selbst, das liege in ihrer «Natur». Im rechten Geschlechterkosmos wird der ganze reproduktive Stress moralisch immerhin aufgewertet.
«Kaum ein Motiv eignet sich vermutlich besser zur moralischen Mobilisierung von Frauen als der Kampf für das ‹unschuldige Kind›».
Die neue Hausfrau wird auf diese Weise zur rebellischen Figur konservativer Kapitalismuskritik. Rechte Geschlechterpolitik bildet den zentralen Angelpunkt, an dem feministische und linke Politik von rechts vereinnahmt wird, weil sie eine alternative, reaktionäre Opposition gegen die Krisen des Neoliberalismus bietet. Die Rechte hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur erfolgreich der wirtschaftlichen und kulturellen Abstiegsängste angenommen, sondern auch feministische Themen – etwa die Krise der Pflege oder die Abwertung von Reproduktionsarbeit – erfolgreich für ihre Zwecke instrumentalisiert.
Im Zentrum der rechten Geschlechterpolitik steht dabei nicht nur eine neu-alte traditionelle Mütterlichkeit, sondern auch das «gefährdete Kind», das man angeblich gegen die «Homosexualisierung» schützen muss. Oder das «gefährdete Leben» (der Fötus), das gegen Abtreibung verteidigt wird. Kaum ein Motiv eignet sich vermutlich besser zur moralischen Mobilisierung von Frauen als der Kampf für das «unschuldige Kind».
Rassismus – die Möglichkeit, sich an Herrschaft zu beteiligen
Ein weiteres zentrales Angebot rechter Politik liegt im Rassismus selbst. Einige Forscher:innen argumentieren, dass eine rassistische Positionierung für Frauen einen besonderen Anreiz darstellen kann – gerade, weil sie als Frauen häufig Sexismus und Abwertung erfahren. Natürlich entschuldigen eigene Unterdrückungserfahrungen «rechts werden» bzw. Rassismus nicht, schliesslich erleben viele Frauen Benachteiligung, und werden trotzdem keine aktiven Rassistinnen. Gleichwohl müssen wir ernst nehmen, dass die Hinwendung zu rechten Positionen gerade Frauen die Möglichkeit gibt, auch als gesellschaftlich «Zweitrangige» aktiv an Herrschaft über andere teilzuhaben. Weiblicher Rassismus ist dabei ausdrücklich nicht als bloss passive Reaktion auf eigene Unterdrückungserfahrungen zu verharmlosen. Die Soziolog:innen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey berichten in ihrem Buch Zerstörungslust von einem aktiven weiblichen Genuss an Dominanz und rassistischer Selbstüberhöhung, von Deportationsfantasien und Rachegelüsten. Betrachtet man zudem aktuelle Inszenierungen von rechtem weiblichem Personal – etwa bei Kristi Noem oder Alice Weidel –, zeigt sich eine durchaus eigenständige weibliche Ästhetik von Grausamkeit und Härte.
Solche radikalisierten rechten Frauen mögen als «extrem» und als Ausnahmen erscheinen – sie knüpfen aber an einen in der Mitte der Gesellschaft weit verbreiteten Rassismus an. Die Psychologin und Pädagogin Birgit Rommelspacher zeigte bereits in den 1990er-Jahren, dass weisse Frauen prinzipiell von einer weissen Dominanzkultur profitieren und diese stabilisieren, auch dann, wenn sie sich antirassistisch positionieren. Gleichzeitig profitieren sie nicht auf die gleiche Weise wie weisse Männer, da Frauen insgesamt weniger Macht haben und gleichzeitig sexistische Benachteiligung erfahren. So oder so sind weisse Frauen für Rassismus prinzipiell genauso empfänglich wie weisse Männer.
An dieser Stelle befinden wir uns mitten in einer feministischen Debatte, die bereits in den 1980er-Jahren intensiv geführt wurde: Damals wurde diskutiert, inwiefern Frauen im Nationalsozialismus Täterinnen oder lediglich Mittäterinnen waren. Mir scheint eine Perspektive sinnvoll, die Frauen nicht entweder als passive Mitläuferinnen oder als aktive Täterinnen begreift. Weisse Frauen bewegen sich vielmehr auf einem Kontinuum zwischen peripherer Teilhabe und aktiver Täterschaft.
Versuch eines Fazits
Abschliessend lässt sich zusammenfassen, dass wir die Rolle rechter Frauen und vor allem rechter Geschlechterpolitik noch besser verstehen müssen. Es reicht nicht, sie als irrationale Verirrung abzutun. Geschlechterpolitik ist das zentrale Feld, auf dem die Krisenauswirkungen des Kapitalismus von rechts besetzt werden und sich eine attraktive reaktionäre Opposition gegen die weibliche Dauer-Erschöpfung formiert.
«Eine Revolution ohne Fürsorge ist keine.»
Was tun? Es gibt nicht die eine richtige Lösung, aber zentral scheint mir, dass feministische Bewegungen eine eigene rebellische, emanzipatorische Position gegen die Erschöpfungskrise der Frauen stark machen – und dieses Feld nicht den Rechten überlassen. An vielen Stellen gelingt das bereits, aber die unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen werden dabei manchmal nicht ausreichend mitgedacht.
Aber nicht nur feministische, sondern alle progressiven Bewegungen müssen endlich Geschlechterfragen, Care und die Krise der sozialen Reproduktion ins Zentrum ihrer Politik stellen. Sie können nicht auf die Frauen verzichten. Und eine Revolution ohne Fürsorge ist keine.
Franziska Schutzbach ist Buchautorin, promovierte Geschlechterforscherin, feministische Aktivistin sowie Dozentin für Geschlechterforschung und Soziologie an der Universität Basel. 2021 hat sie den Bestseller «Die Erschöpfung der Frauen. Wider die weibliche Verfügbarkeit» veröffentlicht.
Die Kolumne ist eine «Carte Blanche» und widerspiegelt die Meinung der Autorin.