Die digitale Öffentlichkeit hat ermöglicht, marginalisierte Menschen und Anliegen sichtbar zu machen, die vor wenigen Jahren noch kaum Beachtung fanden. Das ist grossartig. Gleichzeitig müssen wir uns fragen, inwiefern die sozialen Medien auch zu Spaltung, Entsolidarisierung und Fehlschlüssen führen und am Ende progressiven Zielen sogar schaden, anstatt sie voranzubringen. Es stellt sich die Frage, inwiefern der digitale Aktivismus unsere Energie und unsere Fähigkeit beschädigt, tragende Bewegungsstrukturen aufzubauen.
«Aufmerksamkeit und viele Likes allein reichen nicht aus, um Veränderungen zu bewirken.»
Studien kommen mittlerweile zum Schluss, dass die sozialen Medien progressiven Anliegen mehr schaden als dienen. Das hat verschiedene Gründe, zentral ist vor allem: Soziale Medien schaffen zwar Aufmerksamkeit für Themen. Doch lässt sich diese Aufmerksamkeit weder mit der eigentlichen politischen Arbeit gleichsetzen noch mit einer Veränderung. Die Dynamiken der sozialen Medien lassen uns fälschlicherweise annehmen, wir wären bereits weiter, als wir eigentlich sind.
Keine konkreten Veränderungen
Aufmerksamkeit und viele Likes allein reichen nicht aus, um Veränderungen zu bewirken. Denn oftmals ist das nur ein Zwischenschritt oder Mittel zum Zweck. Es braucht Bündnisarbeit, Zusammenschlüsse, langfristige Bewegungen, die hartnäckig, kontinuierlich und über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, um bestimmte Ziele zu erreichen. Veränderung funktioniert nicht – oder nur kurzfristig und nicht nachhaltig –, indem einzelne auf Instagram, TikTok oder Twitter sagen: «Jetzt muss sich etwas ändern.» Der Bewegungsforscher Gal Beckerman formuliert es in einem Interview zu Black Lives Matter, MeToo und anderen Bewegungen so: «Ich fürchte, was wir in den letzten 10 oder 15 Jahren gesehen haben, sind Bewegungen, die sehr hell aufscheinen, aber nicht wirklich konkrete Veränderung erreichen.»
«Mit Blick auf den feministischen Streiktag am 14. Juni plädiere ich darum dafür: Raus aus dem Internet, rein in die feministischen Streikkollektive! Oder in andere Strukturen, die diese Art der längerfristigen Organisierung bereits machen.»
Natürlich ist es wunderbar, Ideen und Kritik schnell verbreiten zu können. Alle können ihre Anliegen über die sozialen Medien verbreiten, ohne auf die traditionellen Medien angewiesen zu sein. Das hat eine grosse Kraft und gab es bisher in dieser Form noch nicht. MeToo zum Beispiel hat eine grosse Debatte ausgelöst. Aber, wie Beckerman anmerkt: «Wenn ich so schnell von null auf hundert gehen kann, wenn ich morgens aufwachen kann und ich bin wütend über eine Sache und innerhalb eines Tages könnte ein viraler Post einen Protest mit ein paar Tausend Leuten auslösen, dann hat man viele Schritte dazwischen ausgelassen.»
Veränderung braucht Organisation
Die Soziologin Zeynep Tufekci schreibt in ihrem Buch Twitter and Tear Gas, dass eine politische Bewegung eigentlich langsam Muskeln aufbauen muss. Der Sinn für Solidarität und Verbindlichkeit muss sich etablieren. Wer mitmacht, muss bereit sein, sich längerfristig zu engagieren. Zudem braucht es eine gemeinsame Vorstellung davon, welche Ziele die Bewegung verfolgt. Alle diese Schritte werden übersprungen, wenn es zu schnell geht. Viral gehen ist das eine – um Veränderungen herbeizuführen, braucht es aber sehr viele Schritte, die nicht öffentlich sind. Gal Beckerman nennt ein Beispiel: Den Busboykott von Birmingham in den 1950er Jahren: Rosa Parks weigerte sich damals, als schwarze Person hinten im Bus zu sitzen, wie es die rassistischen Gesetze verlangten. Das allein bewirkte noch keinen Wandel. Auf Parks Aktion folgte jedoch ein organisierter Boykott. Die Aktivist:innen schafften es, ein ganzes Jahr lang, die Busse nicht zu benutzen und zwangen so die Stadt an den Verhandlungstisch. Was in diesem Jahr passierte, war viel mehr als ein Tweet, es steckte viel Arbeit dahinter. Den Menschen musste beispielsweise ermöglicht werden, dass sie ohne Bus zur Arbeit kommen. Es wurden Fahrgemeinschaften, Kinderbetreuung und vieles mehr organisiert.
Mit Blick auf den feministischen Streiktag am 14. Juni plädiere ich darum dafür: Raus aus dem Internet, rein in die feministischen Streikkollektive! Oder in andere Strukturen, die diese Art der längerfristigen Organisierung bereits machen.
Polarisierung erzielt Reichweite
Die sozialen Medien sind aber auch in anderer Hinsicht schädlich: Die grösste Aufmerksamkeit erhalten polarisierende, nicht differenzierende Meinungen. Diese Plattformen wurden nicht geschaffen, um eine demokratische Öffentlichkeit zu fördern. Es sind Grossunternehmen, deren Ziel der Profit ist. Soziale Medien wollen Menschen möglichst lange auf der Plattform halten, weil es um nichts anderes als Werbung geht. Wie hält man die Leute dort? Indem besonders krasse, polarisierende und emotionalisierende Inhalte die grösste Reichweite erhalten. Entsprechend verzeichnen rechtsextreme, islamistische, maskulistische usw. User auf TikTok heute den grössten Zuwachs an Aufmerksamkeit. Den grössten Zulauf haben Angebote, die ein Weltbild von «gut» und «böse», eine Logik von «falsch» und «richtig» anbieten und eine Kultur der gegenseitigen Bewertung, Herabwürdigung und Anprangerung bestärken. Soziale Medien befördern das Gegenteil von demokratischem Diskurs und Argumentation – sie verstärken Ressentiments, Vergeltungs- und Rachegefühle.
«Wenn wir tragende Bewegungen aufbauen wollen, braucht es Räume, in denen wir angstfrei sprechen können, ohne dass dieses Sprechen sofort von bestimmten Interessen und medialen Logiken instrumentalisiert wird.»
Das Versprechen der Aufmerksamkeit durch polarisierte Inhalte verleitet auch besonnene Menschen zu schnellen Statements und polemischen Äusserungen. Das öffentlich werden von allem und allen hat in den vergangenen Jahren eine Art abstrahierende Positionierungs-Schlacht verursacht, die zu schnellen gegenseitigen Bewertungen und Absolutismus verlockt. Ohne ein lebendiges, reales Gegenüber können wir austeilen und uns positionieren, ohne die Wirkung von unserem Handeln in einem Gegenüber wirklich wahrzunehmen. Wir sehen die Verletzung und Kränkung der anderen Person nicht. Nuancen und Körpersprache gehen auf Social Media verloren: das Brechen einer Stimme, die Angst oder Beklemmung in den Augen des Gegenübers werden beispielsweise nicht mehr wahrgenommen. Das führt zu schnellen Meinungen, zu scharfen Worten– kurz: Wir verhalten uns, wie wir uns in Gesprächen mit realen Menschen niemals benehmen würden.
Wenn wir tragende Bewegungen aufbauen wollen, braucht es Räume, in denen wir angstfrei sprechen können, ohne dass dieses Sprechen sofort von bestimmten Interessen und medialen Logiken instrumentalisiert wird. Wir brauchen wieder mehr Räume, in denen gesprochen wird, nicht um Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit zu generieren, sondern um Verständigungsprozesse und Verbundenheit zu ermöglichen.
Franziska Schutzbach ist Buchautorin, promovierte Geschlechterforscherin, feministische Aktivistin sowie Dozentin für Geschlechterforschung und Soziologie an der Universität Basel. 2021 hat sie den Bestseller «Die Erschöpfung der Frauen. Wider die weibliche Verfügbarkeit» veröffentlicht.
Die Kolumne ist eine «Carte Blanche» und widerspiegelt die Meinung der Autorin.




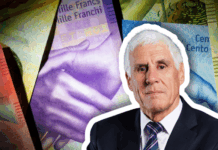

„Wenn wir tragende Bewegungen aufbauen wollen, braucht es Räume, in denen wir angstfrei sprechen können“ Ja, genau deshalb formiert sich erst der Widerstand der Männer*(rechts)bewegung, jetzt im anonymen Internet: Weil in der Gesellschaft jegliche Kritik an Frauen* oder Feminismus geächtet wird.
Frauen* haben sich schon immer kollektiv organisiert und gewehrt, um ihre gemeinsam Interessen (auch gegen die Männer*) durchzusetzen. Sie mögen es nicht, wenn Männer* plötzlich auch Aufmerksamkeit für ihre Probleme und Interessen bekommen, weil sie sich anony getrauen, ihren Probleme zu besprechen und halt auch ab und zu die Frauen* dafür mitverantwortlich sind.
Die Probleme der Männer* werden in unserer Gesellschaft und Kultur individualisiert und wer es wagt, Schwäche zu zeigen, Frauen* zu kritisieren oder sich auch nur beschwert, wird sozial vernichtet.
Als Mann* hat mensch einfach zu schweigen und sich selbst zu helfen. Das wird dann einerseits als toxische Männlichkeit kritisiert, aber andererseits wird von denselben Leuten (v. a. Frauen*) jede Thematisierung von Männer*problemen mit allen psychologischen, sozialen und rhetorischen Mitteln bekämpft. Nicht, dass noch die Gesellschaft auf die Idee kommt, Männern* gleich viel Empathie oder Wert zuzumessen!^^
Die Probleme der Frauen* dagegen wurden schon immer sozialisiert: Nicht die einzelne Frau* wird verantwortlich gemacht, sondern das System, die Gesellschaft, die Männer*, das Patriarchat (das es schon lange nicht mehr gibt bei uns).
Wenn Männer* sich erst ein grossem Stil als Kollektiv mit gemeinsamen Interessen verstehen würden, was sie aufgrund evolutionärer Prägung viel weniger können als Frauen* (Sozialisierungseffekte gibt es natürlich auch), dann könnten sie dem Frauen*kollektiv ja widersetzen.
Und nein, ich glaube nicht, dass es nur einen Geschlechterkampf als Nullsummenspiel gibt, aber zu verleugnen, dass es viele entgegengesetzte Interessen gibt und die Frauen* kollektiv voraus sind, wäre auch nicht angemessen.
Wie schaffen es Feminist*innen nur, so zu tun, als seien Frauen* eine benachteiligte, unterdrückte Klasse, während sie vermeintliche „Gleichstellungsanliegen“ gegen die Interessen der Männer* durchdrücken können und dabei, ohne rot zu werden, lügen, diese seien gut für alle und nicht zum Nachteil der Männer*? Mensch kann nicht gleichzeitig so tun, als sei es ein Nullsummenspiel und dann trotzdem immer behaupten, es wäre gut für alle – mal ganz abgesehen davon, dass viele Forderungen es oft wenig mit Gleichberechtigung zu tun haben.
„“mein einziger Fehler war, dass ich eine Frau bin“, sagte einmal ein Mann zu mir, der meine Aktivitäten auf dem Gebiet der Luftrettung in Deutschland verfolgte.
„Ihr einziger Fehler war, dass sie eine Frau sind“, sagte einmal ein Mann zu mir, der meine Aktivitäten auf dem Gebiet der Luftrettung in Deutschland verfolgte.