Mit der sogenannten «Blackout»-Initiative will der mitte-rechts positionierte Energie Club Schweiz neue Atomkraftwerke (AKW) bauen. Obwohl der Bundesrat die Initiative ablehnt, setzt er die Ziele der Initiative mit einem Gegenvorschlag direkt um: Das Kernenergiegesetz soll so abgeändert werden, dass neue Rahmenbewilligungen für Atomkraftwerke wieder erteilt werden können, was seit Inkrafttreten der Energiestrategie 2050 verboten ist.
«direkt» zeigt auf, warum die Hochrisikotechnologie nicht zielführend, sondern vielmehr problematisch und umweltschädlich ist.
1
Gefahr eines Super-GAUs bleibt
Dass Atomenergie keine nachhaltige, sichere Technologie ist, wurde uns in den letzten Jahren immer wieder vor Augen geführt. 2011 kam es in Fukushima nach einem Tsunami gleich zu mehreren Kernschmelzen. In weniger als 30 Jahren seit dem Unfall in Tschernobyl kam es zu drei weiteren Super-GAUs. Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine blickt ganz Europa immer wieder mit Entsetzen auf Saporischschja, dem grössten AKW des Kontinents. Bereits mehrfach brach der Kontakt ab oder Geschütze schlugen in der Nähe des Reaktors ein. Die Gefahr einer Atomkatastrophe steigt überdies mit der Zunahme von Wetterextremen, die zur neuen Normalität werden. Darum bleibt das Restrisiko selbst ohne kriegerische Auseinandersetzung gross.
2
Abhängigkeit von autokratischen Regimes
Eine Stärkung der Atomenergie würde die Schweizer Abhängigkeit von autokratischen Staaten wie Russland erhöhen. Denn nur wenige Staaten bauen das benötigte Uran ab. Die Schweizerische Energie-Stiftung schreibt: «Deutlich mehr als die Hälfte der weltweiten Produktion stammt aus Staaten, die gemäss dem Freedom-House-Index als nicht frei gelten.» Der Index kategorisiert Staaten nach dem Grad ihrer politisch-zivilen Freiheit: Kasachstan etwa, der weltweit grösste Uranproduzent, hat einen sehr niedrigen Indexwert.
3
Grosse Umweltschäden durch Uranabbau
Das in den Schweizer AKWs verwendete Uran stammt aus Russland und teilweise aus westlichen Ländern wie Kanada, Australien oder den USA. Abbau und Transport von Uran verursachen grosse Umweltschäden. Das menschliche Leid ist verheerend. Oft befinden sich die Minen auf dem Land von indigenen Völkern. Diese arbeiten ohne Strahlenschutz in den Minen. Ganze Landstriche bleiben radioaktiv verseucht zurück. Menschen, die dort leben, werden schwer krank. Uran ist zudem keine erneuerbare, sondern eine schwindende Energiequelle. Je mehr abgebaut wird, desto weniger wird es auf dem Markt geben und desto teurer wird die daraus gewonnene Energie werden.
4
Zu langsam und zu teuer
All diese Punkte erwähnt der Energie Club Schweiz in seiner Argumentation nicht. Stattdessen versucht der Verein mit dem Schreckensszenario eines Strom-«Blackouts» die Bevölkerung von seinem Anliegen zu überzeugen. Dabei verschweigt er, dass die Planung und der Bau von neuen Atomkraftwerken Jahrzehnte dauert und extrem teuer ist. Schätzungen zufolge könnte ein neues AKW frühstens Mitte der 2040er-Jahre ans Netz gehen. Die Kosten dafür wären horrend und würden von der Bevölkerung bezahlt werden. Diese müssten beim Ausbau von erneuerbaren Energien eingespart werden. Damit wäre die Versorgungssicherheit gefährdet und die «Blackout-Initiative» würde zur befürchteten Stromlücke womöglich selbst beitragen.


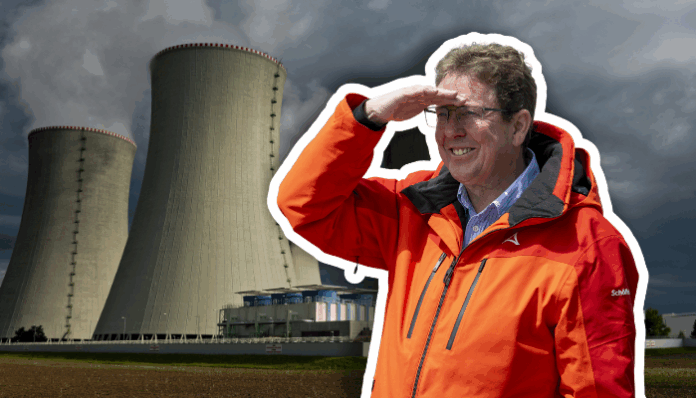



Europa inkl der Schweiz müsste meiner Ansicht nach bei Geschäften in erster Linie Europa berücksichtigen, ob es sich um Gemüse oder Kriegsflugzeuge handelt. Warum schreckt die Tatsache, dass der amerikanische Flieger nicht fliegen wird, wenn die USA es so entscheidet, die Bevölkerung nicht auf? Weiss man das nicht?
Das Volk hat gesprochen. Dann macht König Röschti der Allergröschti was er will.