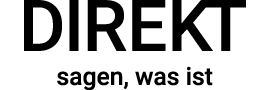Weltweit setzen konservative, rechte und religiöse Parteien und Bewegungen wieder verstärkt auf Anti-Abtreibungspolitik. Der US-Supreme Court hat das nationale Recht auf Abtreibung abgeschafft, Brasiliens konservative Kongressmehrheit will den Schwangerschaftsabbruch mit Mord gleichsetzen, in Deutschland demonstrieren rechte Katholik:innen gegen Abtreibung. Auch in der Schweiz haben SVP Politiker:innen zwei Initiativen lanciert, um Abtreibungsrechte einzuschränken. Die Initiativen scheiterten glücklicherweise bereits an der Unterschriftensammlung – allerdings recht knapp.
Die Frage bleibt: Warum ist das Thema in der reaktionären Politik so erfolgreich?
Der Fötus als Hoffnungsträger
Zunächst: Reaktionäre Politik stützt sich gern auf Emotionalisierung, Aufpeitschung und Empörung. Das Thema Abtreibung eignet sich dafür perfekt: Der Schwangerschaftsabbruch wird seit Jahrzehnten als «Mord» skandalisiert. Gleichzeitig gaukelt die Anti-Abtreibungspolitik vor, auf der Seite des Guten zu stehen, und mit dieser Haltung «das Leben» und damit die Zukunft zu schützen. Bereits in der Nachkriegszeit wurde der Fötus zu einer obsessiven Projektion für Hoffnung und Unschuld: Erwachsene zerstörten in zwei Weltkriegen ihren Lebensraum und bauten ein atomares Selbstvernichtungssystem auf, sodass sich viele nach dem «Guten» sehnten. Diese Sehnsucht liess sich hervorragend auf das ungeborene Leben projizieren, das noch keine Gelegenheit gehabt hatte, Böses zu tun. Der Fötus wurde zum Repräsentanten des Menschen als reines unbeschriebenes Blatt.
«Der Fötus wurde zur Erlöserfigur einer verrotteten Gegenwart.»
1965 publizierte der schwedische Starfotograf Lennart Nilsson im amerikanischen Life-Magazin riesige Bilder von daumenlutschenden Föten. Die Fotos gingen um die Welt und setzten sich im kollektiven Gedächtnis fest. Sie zeigten den Fötus als autonomes Wesen, das schön, unschuldig und vollkommen ist und unser aller Schutz bedarf. Abtreibungsgegner:innen nutzten seither die Fötus-Ikonographie und betrieben eine weltweite Heiligsprechung. Der Fötus wurde zur Erlöserfigur einer verrotteten Gegenwart.
«Die Obsession für das Ungeborene verschleiert, dass die politischen Angebote dieser Kräfte den meisten Kindern auf der Welt weder Schutz noch soziale Verbesserungen bieten.»
Genau diese Sehnsüchte nach dem Guten und Unschuldigen nutzen Abtreibungsgegner:innen auch heute wieder, um rückwärtsgewandte antifeministische Politik salonfähig zu machen. Mit der Verehrung des ungeborenen Lebens lenken rechts-konservative Kräfte vor allem auch davon ab, dass ihre konkreten Polit-Programme die geborenen Kinder meist im Stich lassen: Die Obsession für das Ungeborene verschleiert, dass die politischen Angebote dieser Kräfte den meisten Kindern auf der Welt weder Schutz noch soziale Verbesserungen bieten.
Abtreibung als Stigma
Ein Blick zurück zeigt: Ab den 1970er Jahren wurden Abtreibungsgesetze liberalisiert. Zahlreiche Politiker:innen unterstützten den Zugang zum legalen Schwangerschaftsabbruch, jedoch häufig mit dem Zusatz, dass eine Abtreibung unerwünscht und falsch sei. In der Schweiz sprach sich 2002 etwa die damalige CVP-Bundesrätin Ruth Metzler für die so genannte «Fristenregelung» aus, betonte jedoch, das Ziel sei «möglichst wenig Abtreibungen». Schwangerschaftsabbrüche sollten durch Aufklärung und Zugang zu Verhütung minimiert werden. Auf diese Weise schien Abtreibung als notwendiges Übel – als etwas, das es eigentlich nicht geben sollte. Anders ausgedrückt: Indem man den Schwangerschaftsabbruch rhetorisch immer mit der Anforderung verknüpft, zu verhüten und sexuell verantwortlich zu handeln, erschien er nicht als Grundrecht, sondern als etwas, das nur notgedrungen zugestanden wird.
«In dem das Thema Verhütung ständig mit der Stigmatisierung von Abtreibung verknüpft wird, bestärkt man jedoch die Vorstellung, dass ungewollte Schwangerschaften und deren Abbrüche verwerflich seien – wenn doch diese dummen Mädchen und Frauen nur endlich richtig verhüten würden!»
Wer abtreibt, wird in dieser Logik bis heute als rückständig und unaufgeklärt wahrgenommen. So lautet eine der häufigsten Fragen, die Mädchen und Frauen nach einer Abtreibung gestellt wird, immer noch: «Weisst du denn nicht, wie man verhütet?»
Natürlich ist der Zugang zu Verhütung und Sexualaufklärung wichtig. In dem das Thema Verhütung ständig mit der Stigmatisierung von Abtreibung verknüpft wird, bestärkt man jedoch die Vorstellung, dass ungewollte Schwangerschaften und deren Abbrüche verwerflich seien – wenn doch diese dummen Mädchen und Frauen nur endlich richtig verhüten würden! Frauen, die abtreiben, werden oft als gescheitert und unverantwortlich angesehen. Auch in liberalen Kreisen ist die Meinung verbreitet, Abtreibung müsste es eigentlich gar nicht mehr geben – ausser vielleicht in Fällen von Vergewaltigung. Die Folge dieser Haltung, wie neue Studien zeigen: Die meisten Frauen fühlen sich schuldig und verheimlichen Schwangerschaftsabbrüche, da sie im Freundeskreis, in der Familie und sogar in Krankenhäusern beschämt werden.
Alle Frauen sind Mütter
In ihrer Rede zur Liberalisierung der Abtreibung in der Schweiz betonte Bundesrätin Ruth Metzler ausserdem, dass es um «Hilfe» für Frauen gehe. Ihr Slogan «Helfen statt richten» unterstrich, dass ungewollt schwangeren Frauen geholfen werden müsse, da sie in misslichen Umständen seien. Diese Rhetorik implizierte, dass Frauen Zugang zur Abtreibung brauchen, weil sie Hilfe benötigen, nicht weil sie selbst über einen Abbruch der Schwangerschaft entscheiden sollen. Das heisst: Eine Abtreibung ist dann akzeptabel, wenn sie eine verzweifelte Reaktion auf soziale Not ist – und nicht etwa, weil eine Frau nicht schwanger sein will. Es wurde unterstellt, dass Frauen nur aufgrund ungünstiger Umstände eine Schwangerschaft abbrechen, nicht etwa, weil sie es tatsächlich so wollen.
Damit reproduzierten auch Befürworter:innen der Liberalisierung das Stereotyp, dass Frauen im Prinzip Mütter sein wollten und Abtreibung gegen ihre Natur sei.
«Wir müssen verstehen, dass sich Anti-Abtreibungspolitik nicht an fundamentalistische Spinner richtet, sondern auf die gesellschaftliche Mitte und die dort weit verbreiteten rückständigen Einstellungen zu Mutterschaft und Frausein zielt.»
Ruth Metzler sagte weiter, dass Abtreibung zwar möglich sein müsse, ein Schwangerschaftsabbruch die betroffene Frau jedoch tief berühre und sie ein Leben lang begleiten werde. Die Vorstellung, dass eine Abtreibung «schwer» sei, festigte sich als gesellschaftliche Erzählung. Auch damit setzte man die Idee von der Mütterlichkeit aller Frauen fort. Wer heute nach «Abtreibung» googelt, ist mit wenigen Klicks beim so genannten «Post Abortion Syndrom» (PAS). Unzählige Seiten behaupten mit fragwürdigen Referenzen, dass alle Frauen nach einer Abtreibung lebenslang leiden würden. Das PAS ist wissenschaftlich nicht haltbar, aber die Abtreibungsgegner:innen haben diese Vorstellung vom Leid der abtreibenden Frau so erfolgreich verbreitet, dass sich Frauen schämen, wenn sie sich nach einer Abtreibung erleichtert oder neutral fühlen.
Kontrolle des weiblichen Körpers
Wir müssen verstehen, dass sich Anti-Abtreibungspolitik nicht an fundamentalistische Spinner richtet, sondern auf die gesellschaftliche Mitte und die dort weit verbreiteten rückständigen Einstellungen zu Mutterschaft und Frausein zielt. Anti-Abtreibungspolitik verstärkt die auch heute vorherrschende Haltung, wonach Frausein und Mutterschaft unauflösbar gleichzusetzen sind. Anders ausgedrückt, bestätigt und verstärkt Anti-Abtreibungspolitik den heteropatriarchalen Verfügungsanspruch über den weiblichen Körper, über Fortpflanzung, weibliche Gratis-Care-Arbeit sowie über «das Leben» schlechthin. Anti-Abtreibungspolitik soll das Unbehagen an der Emanzipation schüren. Sie dockt an das Gefühl an, dass es mit der feministischen Emanzipation auch mal reiche und bedient das gesellschaftliche Unbehagen darüber, dass Frauen die traditionelle Rolle der «Gebenden» verlassen und selbstbestimmt leben. Sie mobilisiert die quer durch alle Lager und Gruppen verbreitete Vorstellung, die Bestimmung der Frauen sei es in erster Linie, sorgende und gebende Mütter zu sein. Darum ist Anti-Abtreibungspolitik besonders in Krisenzeiten erfolgreich. Die Menschen sehnen sich nach Geborgenheit und Sicherheit: Wenn die Welt untergeht, sollen wenigstens die kümmernden Frauen als Mütter verlässlich zur Verfügung stehen.
«Uns muss klar sein: Das Recht auf Abtreibung steht nicht auf solidem Boden. Es gibt viele moralische Vorbehalte, es ist angreifbar.»
Gegen die Stigmatisierung
Uns muss klar sein: Das Recht auf Abtreibung steht nicht auf solidem Boden. Es gibt viele moralische Vorbehalte, es ist angreifbar. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Abtreibung in vielen Ländern nach wie vor im Strafgesetz geregelt ist – und nicht als Recht oder als Frage der medizinischen Grundversorgung. Die Antwort darauf muss die Entstigmatisierung sein. Dazu gehört, dass Abtreibung als Element der Selbstbestimmung der Frauen verstanden wird und auch, dass sie in demokratischen Gesellschaften ein Grundrecht und Teil der medizinischen Grundversorgung wird.
Franziska Schutzbach ist Buchautorin, promovierte Geschlechterforscherin, feministische Aktivistin sowie Dozentin für Geschlechterforschung und Soziologie an der Universität Basel. 2021 hat sie den Bestseller «Die Erschöpfung der Frauen. Wider die weibliche Verfügbarkeit» veröffentlicht.
Die Kolumne ist eine «Carte Blanche» und widerspiegelt die Meinung der Autorin.